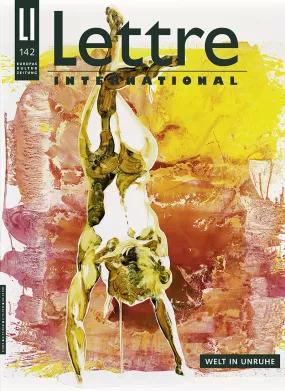LI 109, Sommer 2015
Blickveränderungen
Die Kultur der Schwelle im Lichte von Prinzip HoffnungElementardaten
Genre: Gespräch / Interview
Übersetzung: Aus dem Französischen von Bernward Mindé
Textauszug: 9.107 Zeichen von 49.670 Zeichen
Textauszug
Heinz-Norbert Jocks: Für mich sind Gespräche wie das, was wir führen, eine imaginäre Form gemeinsamen Reisens ins Innere des anderen. Ich frage mich, welche Reiseform die Ihnen gemäße ist. Auch Schreiben bedeutet ja Reisen, aber auf alleinigen Beinen, während das Kuratieren eine Art von Gruppenreise ist.
Georges Didi-Huberman: Mir sind zwei Weisen des Reisens eigen, und ich brauche beide. Das Alleinreisen ist mir wichtig, weil ich dabei meiner eigenen Geschwindigkeit folgen kann. Insofern betrete ich ein Museum ungern in Begleitung. Es kann passieren, daß ich an einem Tag keine Lust habe oder nicht in der Verfassung bin, mich auf ein Meisterwerk einzulassen. Also gehe ich weiter und verweile dafür länger vor etwas, das mit Sorgen, Problemen, Nöten oder Beunruhigungen koinzidiert, die mich beschäftigen. Gleichzeitig bedaure ich oft, die Erfahrung von etwas Schönem nicht mit jemandem teilen zu können, den ich gern habe. Es gibt also beides, aber ich brauche diese Einsamkeit.
(…)
Der Künstler ist heute eine Figur sowohl der Freiheit als auch der Souveränität. Das heißt, ein Künstler, vom Museum eingeladen, eine Ausstellung zu machen, wünscht ein bestimmtes Format, will eine bestimmte Hängung, zudem dies und das, und der Kurator willigt ein. Der Künstler ist heute fast der einzige, der souverän ist. Doch es gibt keinen legitimen Grund dafür, daß er aufgrund einer Fetischisierung seines Werks zu einer der wenigen Figuren von Souveränität und Freiheit stilisiert wird. Davon handelt die große Debatte zwischen Pasolini und Warhol. Pasolini wirft Warhol vor, die perfekte Figur der Freiheit zu sein, aber das Problem dabei sei, daß er mit seiner Freiheit ganz alleine sei, weil ihn die Frage nach der Freiheit der anderen überhaupt nicht kümmere; Pasolini hingegen stelle sich vor allem diese Frage. Die beiden sind zwei völlig antithetische und zugleich komplementäre Künstlerfiguren. Klar ist ihre Beziehung auch von gegenseitiger Bewunderung geprägt.
Statt Warhol und Pasolini könnte man auch Godard und Pasolini gegenüberstellen. Auch Godard ist eine Figur der totalen Souveränität. Doch wie geht er mit der Souveränität der anderen um? Wie weit reicht seine Liebe zu den Statisten, dem kleinen Volk in seinen Filmen? Für mich ist er eine exemplarische Figur desjenigen, der sich seine Freiheit bestätigt, indem er nie aufhört, sich die Frage der Freiheit der andern zu stellen, um die er sich sorgt. Das ist eine politische Haltung, die ich an ihm bewundere. Das ist heute, wo die Souveränität des Künstlers als heiliges Ego zelebriert wird, alles in allem keine Selbstverständlichkeit mehr. Aber wie ist es um die Freiheit im allgemeinen bestellt? Was bedeutet die Freiheit der Kunst, wenn nur sie alleine frei ist? Was ist damit erreicht? Meines Erachtens nach gar nichts.
Apropos Pasolini, in einem Ihrer Bücher über ihn, speziell hinsichtlich des Phänomens der Illusion, beklagen Sie den Verlust des Prinzips Hoffnung in seinem Werk und Leben. Bezüglich der Frage, wieviel Freiheit uns innerhalb des Systems des kommerziellen Totalitarismus bliebe, sagen Sie, dieser könne nie ein absoluter sein. Insofern wäre jeder Zweifel am Prinzip der Hoffnung unbegründet. Schon deshalb, weil sich weder der Zufall vollständig eliminieren noch eine absolute Notwendigkeit durchsetzen ließe, und weil die Veränderung unaufhaltbar sei. Mir scheint die Dialektik von Verschwinden und Erscheinen ebenfalls darauf zu beruhen, daß die Zeit eine sich fortlaufend verändernde und alles verändernde ist.
Was Sie da sagen, ist ungeheuer wichtig. Ich werde Ihnen auf zwei Weisen antworten. Wenn man es philosophisch betrachtet, so erliegt man bereits einem Irrtum, sobald man ein Absolutes setzt. Und es nervt mich, wenn Dichter wie Heine oder Philosophen ein Wort wie „rein“ so unbekümmert in den Mund nehmen. Es gibt nichts Reines. Rein ist gar nichts. In dieser Hinsicht bin ich Aristoteliker, kein Platoniker. Wenn ich von einem mehr historischen Standpunkt ausgehe, so schießen mir Wörter wie „Endlösung“ oder „Auslöschung“ durch den Kopf. Beide beinhalten die Tötung aller. Das an der Geschichte der Schoah Unglaubliche ist, daß es keine Auslöschung gab. Es war ein gigantisches Massaker, aber keine Auslöschung, denn es gibt Überlebende. In meiner Kindheit fühlte ich mich wie ein Resultat des Mißerfolgs der Auslöschung; wäre ich das nicht, säße ich heute nicht vor Ihnen. Nicht nur meine Großeltern sind umgebracht worden, auch viele Angehörige meiner Familie, aber nicht meine Mutter. Ihr gelang es, zu entkommen. Deshalb verstehe ich mein Leben als einen Ausnahmefall der Auslöschung. Natürlich bin ich nicht der einzige. Die Geschichte behält stets einen Rest zurück, mag er auch noch so klein und noch so armselig ausfallen. Mit diesem Rest muß man arbeiten, und genau das ist mit Nachleben der Bilder, so der Titel meines Buches, gemeint. Das Buch Bilder trotz allem, zusammen mit Peter Geimer verfaßt, ist mein mir bisher wichtigstes, weil darin alle Probleme auf theoretischer Ebene miteinander verwoben sind. Dabei wird deutlich, daß kleine Bilder die dem Auslöschungswahn zum Opfer gefallenen Menschen überlebt haben. Die Menschen sind tot, aber die Bilder immer noch da, und sie leben weiter. Diese Bilder behalten weiterhin einen Gebrauchswert, insofern sie neue Blicke erlauben, wodurch sie sich auf neue Weise betrachten lassen. Das macht die wunderbare Macht der Bilder aus, ihre Kraft des Nachlebens. Es gibt also kein Absolutes.
(…)
Das heißt wohl auch, daß Sie auf der Ebene des Denkens gerne Blickveränderungen provozieren?
Ja, ich liebe es, Blickpunkte, Winkel, Ausschnitte und Montagen unaufhörlich zu variieren. Um Ihnen zwei völlig unterschiedliche Beispiele zu geben, die sich aber gleichen: Bei meiner Arbeit über die Malerei der Renaissance widerfuhr es mir, daß ich mich, anstatt mich dem gemalten Gegenstand, der Jungfrau Maria und Christus bei Giotto zu widmen, mehr für den Hintergrund, das Dekor wie den Stuckmarmor interessierte. Und genau das erinnert mich an Gerhard Richter. Bei dieser Betrachtungsart rückt provisorisch in den Vordergrund, was sich für gewöhnlich im Hintergrund befindet. Als ich mich mit dem Los der Filmstatisten befaßte, ging ich auf ähnliche Weise vor. Ich warf den Blick nicht auf den Star des Films. Vielmehr schaute ich mir an, wie der Regisseur diejenigen filmte, die nichts zu sagen haben, also den menschlichen Hintergrund. Das bedeutet eine Enthierarchisierung des Blicks. Man muß, wenn auch nur provisorisch, die Hierarchien des Blicks verschieben, und das ist gar nicht so kompliziert.
Bei der Lektüre Ihrer Bücher fällt auf, daß Sie, um etwas zu verstehen, ins Innere des anderen zu gelangen versuchen. Bei Pasolini ebenso wie bei Brecht und Benjamin. Mir scheint, als versuchten Sie, deren Blick nachzuvollziehen. Ihre Vorgehensweise wirkt universitär und ist es doch nicht.
So ist es. Meine Vorgehensweise ist völlig durchsichtig, insofern ihr eine Methode zugrunde liegt. Ohne eine solche kann man nichts machen, man muß streng, bescheiden und sensibel sein und mit dem Sensiblen spielen. Das heißt, daß eine Annäherung oder phänomenologische Herangehensweise nötig ist, wie sie im universitären Bereich üblich ist, also mit Anmerkungen, Zitaten etc. Dazu fällt mir Ludwig Binswanger ein, der Leiter der psychiatrischen Heilanstalt, deren Insasse Aby Warburg nach einem schweren psychotischen Zusammenbruch zwischen April 1921 und August 1924 war. Binswangers Idee zum Wahnsinn ist wunderschön, er sagte, Wahnsinn sei ein Stil. Jeder hat seinen Stil der Annäherung an die Welt, seine Ängste vor der Welt, und so auch der Wahnsinnige. Alles, was erscheint, hat einen anderen Stil. Wenn Sie mir die Neigung zusprechen, mich ins Innere eines anderen vorzutasten, so denke ich an mein Buch Phasmes. Nun ist „phasme“, die Gespensterheuschrecke, ein Tier, das vollkommen mit seinem Milieu verschmilzt. Gegenüber Schriftstellern und Malern, über die ich schreibe, verhalte ich mich wie dieses Geschöpf. Da geschieht etwas, das dazu führt, daß ich ganz nahe herangehe und deren Art und Weise assimiliere. Mein Buch über Warburg glich Warburg, da ist mir eine unbewußte Imitation seines Stils unterlaufen. Man mußte viele Anmerkungen streichen. Durch eine solche Form der Leidenschaft erhält jedes Werk seinen eigenen Erscheinungsstil.
Es geht Ihnen wohl um die Entdeckung der Welt durch die Augen des anderen!
Ja, die sind ebenso wichtig wie meine eigenen. Denken Sie an das im Jahre 1656 gemalte Bild Las Meninas von Velázquez im Museo del Prado: Alles ist auf dem Bild, nichts ist verborgen, und doch sieht niemand die gleichen Dinge; und so ereignet es sich, daß zehn Jahre später jemand kommt und behauptet, ihm sei etwas aufgefallen, was bisher noch niemand gesehen habe. Das entspricht der Idee, wonach die Dinge, die den Bereich des Blicks berühren, nicht einfach nur eine epistemische Kompetenz haben. Ein Maximum an Wissen ist erforderlich. Letztlich ist Sehen keine Kompetenz. Ich kann nicht besser sehen als irgendwer sonst. Leider glauben das manche. Ich weiß etwas mehr, wenn ich mir beim Arbeiten den Blick eines anderen aneigne.
(…)