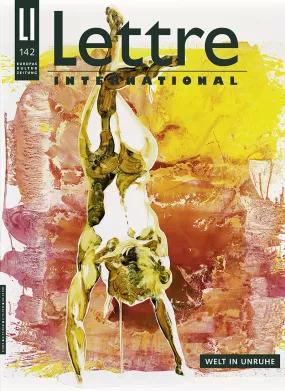LI 115, Winter 2016
Wunde und Wunder
Goethes italienisches Geheimnis – zur "Italienischen Reise" vor 200 JahrenElementardaten
Textauszug
„JEDER MENSCH ist ein Abgrund“, hat einst schon der Dichter, Mediziner, Historiker Georg Büchner befunden. Kein Wunder also, daß Geheimnisse und Rätsel in vielen Leben nisten, besonders in den Werken, in den Existenzen der Künstler, der Erfinder und Weltbaumeister.
Wir kennen weder den wahren Namen noch den Ursprung Homers und können uns kaum eine Vorstellung machen von der in ihrer fabelhaften Präzision schier unfaßlichen Überlieferung jener 27 800 Hexameterverse, welche die vor fast drei Jahrtausenden als rein mündliche Epen begründeten Dichtungen der Ilias und der Odyssee verkörpern.
Wir wissen bis heute nicht wirklich, wer das lebende Vorbild von Leonardos Mona Lisa war und wem ihr zum Begriff der Kunstgeschichte gewordenes Halblächeln gilt. Wir wissen auch nicht, was Giorgiones sonderbar magisches, „La tempesta“ /„Das Gewitter“ genanntes Gemälde in der Galleria dell’Accademia in Venedig darstellt: eine nackte, ihr Kind stillende junge Frau und ein in einiger Entfernung im vollen Gewand sinnierender, auf einen Wanderstab gestützter lockiger Mann in idyllischer Landschaft vor einer imaginären Stadt, unter einem Himmel, durch den ein Blitz zuckt, der einer am Boden, im Gewächs nahezu verborgenen kleinen Schlange ähnelt. Oft wurde das Bild als eine Variation der Ruhe auf der Flucht nach Ägypten gedeutet. Aber keine biblische, keine mythologische Szene paßt wirklich zu den Details dieser Komposition, mit der Giorgione dem Betrachter offenbar eine Geschichte erzählt. Aber welche?
Man kann die Beispiele noch erweitern. So hat die um das Jahr 100 nach Christus im präaztekischen Teotihuacán in der Nähe von Mexiko-Stadt entstandene Sonnenpyramide mit 225 Metern Länge an den vier Seiten ihrer quadratischen Basis auf erstaunliche Weise die identischen Maße wie die vor viereinhalb Jahrtausenden erbaute Cheops-Pyramide in Gizeh am Rand von Kairo. Gab es also über zwei, drei Kontinente und zwei Meere hinweg schon weit mehr als ein Jahrtausend vor Kolumbus einen Dialog der Zivilisationen und ihrer wohl auf Sternbildern beruhenden architektonischen Berechnungen? Wir haben bis heute keine Antwort.
Und: Wie verrückt oder auch nur genial entrückt war Friedrich Hölderlin während seiner 35 Jahre im Turmzimmer von Tübingen? Warum hat Arthur Rimbaud im Alter von 17 Jahren für immer aufgehört zu dichten? Oder noch diese scheinbar nebensächliche Bemerkung aus Heinrich von Kleists Prinz von Homburg: Im vierten Akt des Stücks sagt der zum Tode verurteilte Homburgprinz: „Das Leben nennt der Derwisch eine Reise / und eine kurze.“ So schreibt es Kleist in seinem letzten Drama, mit dem er gleichermaßen eine Todes- und Überlebens-Euphorie beschwört – vor seinem Selbstmord, am Ende seiner eigenen, allzu kurzen Lebensreise. Indes bleibt der erwähnte Derwisch rätselhaft. Denn weder im Homburg noch im übrigen Werk von Kleist kommt jemals ein Derwisch vor.
AUSBRUCH AUS WEIMAR
Natürlich läßt sich mit Goethe sagen, ein Kunstwerk sei im Grunde „inkommensurabel“. Also in seiner ästhetischen Eigengesetzlichkeit nicht völlig ermeßbar. Allerdings geht es im folgenden Fall nicht um die isolierte Interpretation einer seiner Dichtungen. Meine Überlegungen zielen auch nicht zuvörderst auf des Autors verborgenes Liebesleben, das in Rom vor 230 Jahren wohl einen seiner Höhepunkte erfuhr. Die Mysterien der ungenannten römischen Geliebten, die als Faustina später durch die Römischen Elegien und viele literaturgeschichtliche Untersuchungen geistert, hat spätestens Roberto Zapperi in seiner literaturdetektivischen Studie Inkognito soweit ergründet und gelüftet, wie es nur möglich erscheint.
Es geht mir um eine andere, für Goethes Werk in seiner zweiten Lebenshälfte folgenreiche Frage.
Das zweihundertjährige Jubiläum der ersten Veröffentlichung der Italienischen Reise, 1816–2016, bietet einigen Anlaß zur Verwunderung. Denn Goethes entscheidende Reise nach Italien fand ja bereits zwischen 1786 und 1788 statt, also dreißig Jahre zuvor. Eine zweite, kürzere Exkursion 1790 nach Venedig, zu dem Zweck, von dort die kunstsinnige Herzogin Anna Amalia, die Mutter seines Regenten und Arbeitgebers Carl August, zurück nach Weimar zu geleiten, ist nur ein Nachspiel, von Goethe eher mißmutig empfunden.
Warum hat der Autor mit der Bearbeitung und schriftstellerischen Montage seiner auf dem Weg nach und dann durch Italien entstandenen Notizen, seiner Tagebuchaufzeichnungen und brieflichen Schilderungen derart lange gewartet?
(…)
Goethe kam aus Weimar. Weimar war Ende des 18. Jahrhunderts ein Ort der Genies, so, wie wenn man in unserer Zeit Princeton, Harvard, Berkeley und Yale gleichsam zu einem Weltdorf vereinen würde. Aber wäre dieses Weltdorf dann auch die Welt?
Hören wir nur, was Goethes Gefährte, Gönner und Boß, Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, kurz nach Goethes Rückkehr an den älteren, beiden gemeinsamen Weimarer Freund und Gelehrten Johann Gottfried Herder schreibt, als dieser sich zu Weihnachten 1788 seinerseits in Rom aufhält. Carl August träumt am 24. Dezember 1788 von den „Genüssen, welche Sie (in Rom) umgeben“, während man in Weimar als „Einwohner unseres verlassenen Himmelsstrichs“ winters am „leidenden Ungenuss“ laboriert. Carl August: „Ein unmäßiger Schnee nahm vollends der Landschaft, die sonsten bei dürrem Froste Reize behält, alle Mannigfaltigkeit. Endlich gesellt sich noch zu allen diesen Unformen ein Tauwetter hinzu, welches diese Nacht mit abscheulicher Gewaltsamkeit eintrat und uns in ein Meer von Kot und zerflossenen Salzen taucht.“
Das schreibt der Fürst, der Schloßherr. Und sagt, daß „in unserm kunstlosen Land“ nur die Kraft der Sprache bleibe, die Existenz unter solchen Umständen zu beklagen und zu ertragen.
Weimar hatte zu Goethes, Schillers, Herders und Wielands Zeit etwa 6 000 Einwohner. In Frankfurt am Main lebten in Goethes Kindheit knapp über 30 000 und gegen Ende des 18. Jahrhunderts noch immer weniger als 50 000 Menschen. In Weimars weiterer Umgebung hatte die Handelsstadt Leipzig um das Jahr 1800 rund 30 000 und die Residenzstadt Dresden gerade 60 000 Bewohner. Nur wenig größer als das Dresdner „Elbflorenz“ war zu Goethes Reisezeit noch das toskanische Florenz, aber in Venedig lebten immerhin gut 130 000 Menschen, fast doppelt so viele ständige Bewohner wie heute. Die zwei Städte Zürich und Straßburg, die Goethe aus seiner Studienzeit und von Besuchen kannte, hatten 12 000 beziehungsweise knapp 50 000 Einwohner. Rom dagegen zählte zu Goethes Zeit mindestens 160 000 Menschen – so überstiegen Venedig und Rom in ihrer Verbindung von Größe, Anlage und historischer Bedeutung alles, was Goethe bis dahin gesehen hatte. Mailand, nach Einwohnern damals etwa so groß wie Rom, hatte ihn gegen Ende der Rückreise aus Italien kaum noch beeindruckt, der spätgotische Dom erschien ihm bloß als abgeschmacktes „Marmorgebirg“.
Auch das muß man sich vorstellen: Der europäische poeta maximus war zeit seines Lebens nie in den Weltstädten Paris, London oder Wien gewesen. Berlin, damals allein von der Einwohnerzahl her mit Rom vergleichbar, hatte er nur ein einziges Mal im Mai 1778 für wenige Tage als Begleiter des jungen Carl August besucht. In Venedig aber hatte er neben den Wundern seiner Architektur 1786 zum ersten Mal das Meer erblickt – und es wiedergesehen und richtig erfahren im Frühjahr 1787, als er nach Neapel kommt. Von der Stadt, dem Golf und dem Vulkan, den er als Liebhaber der erdinneren Kräfte zweimal bis hin zum gefahrvollen Kraterrand besteigt, zeigt sich Goethe dann überwältigt.
(…)