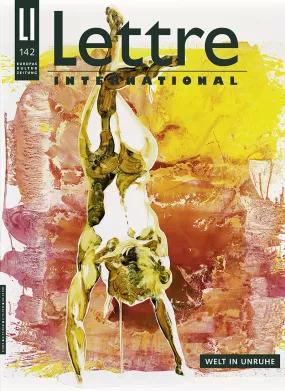LI 76, Frühjahr 2007
Das Lachen Kinshasas
Eine postkoloniale Stadt und ihre unsichtbare ArchitekturElementardaten
Textauszug
(…) In Kinshasa zählt vor allem der Körper. Wo Steine fehlen oder Beton einstürzt, ist ein anderes Material gefragt, nämlich der menschliche Körper. Allein die Tatsache, daß so viele Körper sich gemeinsam bewegen, arbeiten, essen, trinken, sich vereinen, beten, tanzen, fasten und leiden, verleiht Kinshasa sein eigenes Temperament, seinen typischen, oft fieberhaften Rhythmus. Der Körper, diese „Wunschmaschine“, wie ihn David Harvey nennt, gibt dem Chaos der Stadt eine gewisse Ordnung. Oder vielmehr sind es diese Körper, die der Stadt ihre eigene zwischenmenschliche Logik aufzwingen. Der Körper ist einer der wenigen Orte, wo die Bewohner Kinshasas ihren brutalen, als bloßes Überleben wahrgenommenen Alltag hinter sich lassen können. Sehr häufig wird dieser Körper auf die Ebene des Bauches oder des Phallus allein reduziert. Doch ist er auch der Ort, an dem individuelle und kollektive Bezugspunkte, Erfahrungen und Phantasien zusammenkommen und sich vermischen. Hier nehmen Begierde und Abscheu, Angst und Traum Gestalt an. Und davon ausgehend erschafft der Körper immer mehr als nur das, was vorhanden ist, eine kaum faßbare Ästhetik, die weder die Stadt noch ihre Architektur des Verfalls bieten können.
Die Bewohner Kinshasas investieren enorm viel Energie in das Überleben, in die Ernährung, Kleidung und Heilung des Körpers. Aber mehr noch investieren sie in ihren Körper, um daraus ein Feuerwerk an Schönheit und Perfektion zu machen. In der ganzen Stadt stählen junge Männer wie besessen ihren Körper. Sie trainieren sämtliche Muskeln beim Boxen, Ringen, Krafttraining und anderen Sportarten. Ihre Frisuren werden immer ausgetüftelter, und manchmal dauert es Stunden, bis der Stil stimmt und die komplizierten Motive ausgeführt sind. Auch die Frauen sind pausenlos damit beschäftigt, sich modisch zu kleiden und die idealen Maße zu erlangen. Ständig sind sie auf der Suche nach Kleidern, Perücken, den Teint aufhellenden Mitteln (kotela) oder ebenso gefährlichen wie beliebten Hormonpräparaten, um üppigere Formen zu entwickeln (ein Schönheitsideal in einem Land der chronisch Hungernden). Für die Kinoi ist der Körper das wichtigste Instrument, um sich selbst zu verwirklichen und sich in private und öffentliche Bereiche einzubringen. Es ist der individuelle Körper mit seinen spezifischen Rhythmen, der den kollektiven urbanen Körper bestimmt. Diese Bemühungen schließen alles ein und bedingen auch bestimmte Formen des gesellschaftlichen Lebens. Für die Frauen ist das gegenseitige Zöpfchenflechten eine gemeinschaftliche Erfahrung, eine Gelegenheit, sich zu treffen, die Seifenopern im Fernsehen anzuschauen und die Klatschgeschichten des berühmten radio-trottoir auszutauschen. Auch die tontines und andere Sparvereine haben sich aus solchen Treffen entwickelt, die der Körperpflege dienten und Bereiche wie Mode, Musik und Tanz einbezogen. Seit den vierziger Jahren war moziki in Brazzaville wie auch in Leopoldville eines der wichtigsten gesellschaftlichen Phänomene eines sich entwickelnden urbanen Bewußtseins. Es handelte sich dabei um eine neue Form gemeinschaftlichen Lebens, die der Entspannung diente, aber auch wirtschaftliche Aspekte hatte. Anfangs versammelten sich bei diesen Zusammenkünften vor allem Frauen, um sich gemeinsam die Zeit zu vertreiben, aber auch, um sich gegenseitig unter die Arme zu greifen, sich materiell und finanziell zu unterstützen. Obwohl von Missionaren häufig als zu frivol kritisiert, spielten diese Treffen eine große Rolle bei der Emanzipation der kongolesischen Frauen sowie bei der Entwicklung neuer Formen urbaner Eleganz. Sie erwiesen sich als wahre sociétés d’élégance. Vorgeführt wurden die Kleider zumeist in Bars, den neuen urbanen Freizeittreffs, wo sich Mode zusammen mit einer ebenfalls neuen Musik, der Rumba, präsentierte. Die berühmtesten moziki wie La Violette, Diamant, La Rose, La Joie hatten häufig den Charakter von Fanclubs. Sie gruppierten sich um populäre Rumbaorchester, die unermüdlich die neue elegante Frau besangen. In einigen dieser moziki zeigten sich die Frauen bei nahezu jeder gemeinsamen Unternehmung in einer neuen „Ausgehrobe“. Kleidung entwickelte sich schnell zum sichtbaren Zeichen für materiellen Erfolg, und dieser wird auf eine äußerst demonstrative Weise vorgeführt. 1957 wurde La Mode gegründet, einer der bekanntesten damaligen Frauenclubs. Er führte als erster etwas Entscheidendes in die sociétés d’élégance ein: das Sponsorentum. Um wöchentlich eine neue Robe vorführen zu können, ließen sich die Frauen des Clubs von den Stoffabrikanten gratis einkleiden. Sie revanchierten sich, indem sie dafür sorgten, daß die neuen, topaktuellen Stoffmuster dank der Popularität ihres moziki zu einem Hit wurden.
Der im urbanen Kontext sich entwickelnde öffentliche Raum verschafft auch dem Körper einen neuen Platz: Was früher noch in den privaten Bereich fiel, wird zum allgemeinen Spektakel. Mehr noch als Prousts Paris ist Kinshasa eine Stadt der Flaneure, eine sehr sinnliche und stolze Stadt, in der Männer und Frauen ausschließlich damit beschäftigt sind, sich in Schale zu werfen und auf den Straßen zu flanieren, um zu sehen und gesehen zu werden. Und den Zuschauern dieses Spektakels der Straße gehen nie die Kommentare aus, mit denen sie den Auftritt eines Passanten bedenken, den Stoff, den eine Frau trägt, wie er beim Gehen ihre Figur und ihre Bewegungen enthüllt: das laszive Schaukeln der Hüften beim Überqueren der Straße (evunda, ein wohlgerundetes Chassis), die perfekte Form ihrer Beine (mipende ya milangi, eine umgekehrte Bierflasche), das Selbstbewußtsein, das sie beweist, die Arme in die Seiten gestemmt, oder auch die Zahl ihrer Halswülste (kingo mwambe, Zeichen weiblicher Schönheit), die Art und Weise, wie sie ihre Zöpfe oder ihre Perücke trägt, die Farbe ihres Teints … kurz, jeden nur möglichen Aspekt einer Person und der Art, wie sie ihren Körper im öffentlichen Raum bewegt oder, in anderen Worten, wie sie ihre Haut zu Markte trägt. All das macht einen großen Teil ihres Prestiges, ihres Gewichts aus, es sichert ihr einen Platz in der Gesellschaft, verhilft ihr zu einer Identität und läßt sie in diesem öffentlichen Raum existieren.
Mode ist in Kinshasa nie ausschließlich eine Angelegenheit der Frauen gewesen. Gegen Ende der fünfziger Jahre entwickelte sich in Leopoldville eine Subkultur von Jugendlichen, der billisme. Vorbild waren Wildwestfilme, die damals in den kleinen Kinos der schwarzen Viertel einer Stadt gezeigt wurden, in der immer noch eine strenge Rassentrennung herrschte. Besonders Buffalo Bill war es, den die Jugendlichen zu ihrem Idol erwählt hatten und der das Vorbild für die damalige Männermode abgab: Auf den Straßen der Cités flanierten die jungen Männer in Jeans und trugen ein Tuch um den Hals, manchmal hatten sie sogar ein Lasso dabei. (Man braucht sich nur die bereits klassischen Photos von Jean „Whisky“ Depara anzuschauen, des berühmten Photographen des Viertels, der wie kein anderer das damalige Kinshasa auf Film gebannt hat.)
Trotz oder vielleicht gerade wegen der extremen Armut, in der viele Kinois leben, wurde in einer Bewegung wie der Société des ambianceurs et des personnes élégantes, kurz Sape („Gesellschaft der Stimmungsmacher und Eleganten“) der Körperkult rasch zu einer wahren Religion der Eleganz. Sie entwickelte sich Anfang der achtziger Jahre um so populäre Persönlichkeiten wie Papa Wemba, „König der Sapeur“, einem äußerst beliebten Sänger, und einigen seiner Freunde wie dem „Colonel Jagger“ oder „Stavros Niarchos, quasi dem elegantesten Mann der Welt“. Diese Bewegung profilierte sich durch richtiggehende Modewettbewerbe, bei denen die jungen Männer sich gegenseitig mit den Kreationen europäischer Modemacher zu übertrumpfen suchten. Gianni Versace, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Weston oder Dolce e Gabana wurden wie Halbgötter verehrt. All das erweckte den Anschein, als könnte allein das Tragen dieser Luxusmarken Zugang zu Europa verschaffen, einer westlichen Welt, die in den Köpfen vieler junger Stadtbewohner die Dimensionen eines Mythos besaß, in der Praxis jedoch unerreichbar war. Heute nennen die jungen Kinois diese Art von Kleidung selbstironisch bilamba mabe, „Scheißklamotten“.
In veränderter Form erlebte Sape einen neuen Aufschwung, als die freikirchlichen Pfingstgemeinden und andere charismatische Bewegungen aus dem Boden schossen und im Lauf des letzten Jahrzehnts das subsaharische Afrika überschwemmten. Die Ikonen des Erfolgs sind heute die Pastoren jener Kirchen. Unter dem Slogan „Man muß sauber gekleidet vor Gott treten“ tragen die wichtigsten Prediger der fundamentalistischen christlichen Bewegungen Anzüge von Armani oder Versace, wenn sie sich ihren Schäflein zeigen.
Es ist eine Art von Politik, die den Körper zum Maß oder Spiegel dessen macht, was sich in der Stadt tut. Das war schon in den Anfängen von Leopoldville so. So zeugt der ungeheuere Erfolg, den die bunt gemusterten Wax-Stoffe in den dreißiger Jahren hatten, von einem aufkeimenden und sich rasch entwickelnden städtischen Bewußtsein, das der neuen Kleidung einen überaus soziokulturellen Gehalt verlieh. Die Stoffe spiegelten die Veränderung der Normen und der kulturellen Werte in einer Gesellschaft wider, die sich einen Weg zwischen Tradition und Moderne bahnte. Ähnlich reflektierten die Namen, die man bestimmten Mustern gab, den Wandel im Konsumverhalten oder auch in der Praxis der Eheschließungen (unter anderem der Entstehung einer neuen Form von städtischer Polygamie). Die Beliebtheit, deren sich die bedruckten Stoffe erfreuten, hing auch mit einer neuen Freizeitkultur zusammen, mit den neuen Formen und Möglichkeiten des gesellschaftlichen Erfolgs und den rapiden Veränderungen in der Arbeitsteilung sowie in der männlichen und weiblichen Rollenverteilung. Die Stoffe wurden schnell zu einer Art Aushang, auf dem man unterschiedliche politische, religiöse oder didaktische Botschaften unterbringen konnte. Sie wurden im wörtlichen Sinn als Werbefläche benutzt, um die unterschiedlichsten Produkte anzupreisen oder die Porträts von politischen und religiösen Führern zur Schau zu tragen. Häufig waren die Stoffmuster und die zumeist moralisierenden Sprichworte und Redensarten aufeinander abgestimmt. Außerdem provozierten die schnell wechselnden Modelle und Muster alle möglichen Kommentare und inoffiziellen Interpretationen, die von der unerschöpflichen Kreativität und oft auch vom spezifischen Humor des radio-trottoirs zeugten. Das Tuch wurde so zur Leinwand, auf der sich eine im Wandel begriffene Welt dokumentierte. Von Liso ya pite, dem „Hurenauge“, oder dem „Auge meiner Rivalin“, bis zum berühmten „Mein Mann kann’s“ oder dem klassischen „ABC“ oder auch dem neueren „Prinzessin-Mathilde-Dutt“ drücken diese aus den graphischen Motiven abgeleiteten Bezeichnungen die gesellschaftliche Bedeutung und den faszinierenden Charakter der Stoffe in ihren unterschiedlichen Ausprägungen aus. Sie verkörpern einheimische Wunschvorstellungen, bei denen Geld, Macht und Sex an erster Stelle rangieren.
(...)