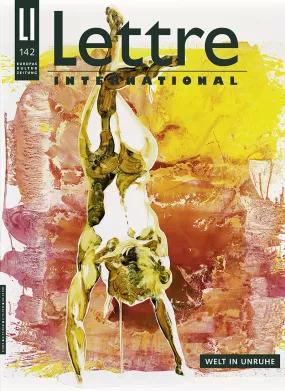LI 82, Herbst 2008
Es war einmal in Paris
Mai 1968 – Von Brüderlichkeit und Libertinage, Politik und DadaismusElementardaten
Textauszug
Jüngere Freunde, Intellektuelle, fragen mich: „Warum hat es ’68 gegeben? Warum fand es in bestimmten Ländern statt, in anderen – zum Beispiel in Großbritannien – aber nicht? Welche Beziehung bestand zwischen den Studentenbewegungen und den Arbeiterbewegungen?“ Naive Fragen, weil sie eine Antwort voraussetzen, die es nicht gibt. Ich meine, daß die Chaos- und Komplexitätstheorie historische Besonderheiten zu erklären vermag, insoweit sie behauptet, daß es eine Erklärung eben nicht gibt. „Der Flug eines Schmetterlings in Brasilien kann einen Tornado in Texas hervorrufen.“ Es gibt niemals den einen Grund, sondern viele Gründe, die, indem sie sich auf stets unvorhersehbare Weise miteinander verbinden, das Geschehnis hervorbringen. Die Komplexitätstheorie jedenfalls erlaubt es, im Wirrwarr des Chaos Attraktoren auszumachen. Alles ändert sich, aber etwas – eine Kraft? – zieht die chaotischen Fluktuationen zu einer Konstante hin. Ein solcher Attraktor des großen Jahrmarkts von damals war der Gemütszustand der Mehrheit seiner Akteure, der, man beachte den Zufall, dem meinen entsprach. Ich lebte in jenen Monaten in einem manischen Rauschzustand. Nicht, weil ich zwanzig Jahre alt war, im Gegenteil. Wie Paul Nizan sagt: „Ich war zwanzig Jahre alt. Und ich erlaube niemandem zu sagen, dies sei das schönste Lebensalter!“ Ich litt aus privaten Gründen, tat aber mein möglichstes, um auf der Höhe der Verwirklichung meiner Träume zu sein. Nur ist das schreckliche an Träumen, daß sie oft Wirklichkeit werden! Etwa mein Traum, zum Studium nach Paris zu gehen, um dort die Seminare von Roland Barthes, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida, Ajuriaguerra, Greimas zu besuchen – genau das, was ich damals wirklich tat. Trotz einer gewissen jugendlichen Naivität hatte ich begriffen, daß diese – fast alle im selben Stadtviertel lebenden – Großdenker weltweit enormen Einfluß auf die Kultur haben würden. Ich fühlte mich am Mittelpunkt der Welt, auch wenn ich mich nicht im Mittelpunkt meiner eigenen Welt fühlte. Alles ließ sich gut an, auch wenn ich dafür einen hohen Preis zu zahlen hatte – mir fehlte die italienische Gefühlswelt, und ich war arm. Mein nicht euphorischer, sondern verträumt größenwahnsinniger Gemütszustand entsprach dem vieler junger Achtundsechziger.
Man hatte den Eindruck, daß sich endlich alles bewegte. Che Guevara war zwar im Oktober 1967 in Bolivien ermordet worden, aber die Tet-Offensive des Vietcong im Januar 1968 demonstrierte, daß die Amerikaner an ihrem vietnamesischen Abenteuer zu scheitern drohten. Die Proteste gegen den Vietnamkrieg hatten in den westlichen Metropolen viele Jugendliche, die sich in einer großen Widerstandsbewegung gegen eine Großmacht wiedererkannten, zueinandergeführt. Die chinesische Kulturrevolution verführte einen Teil der Intellektuellen: Man sah in ihr eine Art dadaistisches Verwerfen von Autorität, an erster Stelle die der Kommunistischen Partei (und tat so, als sähe man nicht die wahnhaft totalitäre Seite dieser Revolution, den erniedrigenden und verblödenden Personenkult um Mao, die Verfolgung der Intellektuellen, die Unterdrückung des Genusses und der Sexualität). Der Prager Frühling, dem Anschein nach das der Chinesischen Revolution entgegengesetzte Signal, bewies, daß im bleiernen Sowjetsystem erneuernde Impulse möglich waren. Die später postmodern genannten künstlerischen und literarischen Avantgarden und Denker verließen ihre Nischen und wandelten sich zu Polen einflußreicher metropolitaner Attraktion. Was „arm“ war, gefiel: das teatro povero (Grotowski), die Arte povera (Celant, -Kounellis usw.), der Minimalismus. Die Darbietungen des anarchischen Living Theatre begeisteten die jungen „Alternativen“ von damals, vor allem in Italien. Ich sah mir ihre Inszenierung von Brechts Antigone des Sophokles innerhalb eines Jahres vier Mal an … Wir spürten die Berauschtheit einer Welt, die sich auf eine Weise ver-änderte, wie wir es ersehnten. Uns schien alles möglich zu sein.
Auch wenn wir dem damals keine Bedeutung schenkten: Die Länder mit heftigen Achtundsechzigerbewegungen befanden sich alle in einem ökonomischen Aufschwung – ungefähr so wie das heutige China. (Ich glaube, unter den jun-gen Chinesen von heute herrscht so etwas wie ein grimmiger Enthusiasmus, ähnlich wie bei uns damals.) Italien erfreute sich eines „Booms“, auch das gaullistische Frankreich prosperierte, und Deutschland war längst die Wirtschaftslokomotive des Kontinents. Im Pariser Mai ’68 hingen an den Mauern Plakate, die den Gaullismus als „Regime der Armut und Arbeitslosigkeit“ anprangerten. In Wirklichkeit gab es in Frankreich zu der Zeit kaum ein paar hundert Arbeitslose – eine für Volkswirtschaftler völlig normale Quote; faktisch herrschte Vollbeschäftigung. Inzwischen hat Frankreich seit Jahrzehnten über 3 Millionen Arbeitslose, aber niemand denkt daran, auf die Barrikaden zu gehen. Kurzum, unser radikaler, totaler und bedingungsloser Protest war nicht das Resultat einer Krise, von Not und Elend oder einer düsteren Zukunftsperspektive, im Gegenteil: Er war der Widerhall einer euphorischen – ökonomischen, kulturellen und politischen – Prosperität eines Teils von Europa. Auch wer sich gegen ’68 positioniert, kann nicht umhin anzuerkennen, daß diese Jahre schön waren.
Wenn ich heute die trockenen Statistiken aus der Zeit lese, sehe ich deutlich, was ich damals nicht wahrnahm, so sehr erfüllte mich das Bedürfnis, im Einklang mit den Leidenschaften meiner Generation zu tanzen. In jenen Jahren veränderte sich – in Frankreich wie in Italien – die Universität; die Sprößlinge aus den Schichten, für die das Studium seit jeher ein Privileg gewesen war, von dem sie sich ausgeschlossen sahen, hatten endlich Zutritt zu den würdevollen Hallen der Universität. Die damaligen leader waren freilich keine Parvenüs der höheren Bildung, sondern entstammten Familien, in denen das Studium selbstverständlich war. So entwickelte sich eine Osmose zwischen denen an der Spitze und am unteren Ende der Klassen, zwischen denjenigen also, die, weil sie eine gesicherte Zukunft hatten, von einer Zukunft träumten, die anders war als die ihnen vorherbestimmte, und denjenigen, die nun Zugang hatten zu einem Ort, der ihnen im Grunde fremd war und dessen Heiligkeit sie heftig ablehnten.
Für mich war Paris damals so etwas wie der Mittelpunkt der Welt, und ich wohnte am Mittelpunkt dieses Mittelpunkts: auf der Île de la Cité, wo Notre Dame einverständig dem Polizeipräsidium gegenüberliegt. Ich, ein mittelloser Student, geradewegs aus dem armen Neapel kommend, fand 1968 Unterschlupf in einer kleinen Wohnung, die an einer der ent-zückendsten und schicksten Ecken von Paris liegt: an der place Dauphine auf der Cité. Ein dreieckiges, mit Kunstgalerien und kleinen Lokalen gespicktes Plätzchen, der ältesten und berühmtesten Brücke von Paris, dem pont Neuf, zugewandt. Picasso hat lange auf diesem kleinen Platz verkehrt, und ein katalanisches Restaurant bei meinem Haus feierte noch seinen Ruhm. In Wirklichkeit war meine kleine Wohnung, zwei Zimmer mit einer winzigen Küche, ein Rattenloch. Das Bad fehlte, und die Toilette lag auf dem Treppenabsatz; im alten Paris gab es damals noch viele solche Behausungen. Zum Glück fand ich eine Geliebte, die eine Wohnung mit Bad hatte. In diesem Luxusviertel lebten freilich noch mehr arme Leute, eine Mischung aus Glanz und Not, die heute unvorstellbar ist – wahrscheinlich wird meine kleine Wohnung heute, gebührend renoviert, für Tausende Euro vermietet. Doch damals waren die sozialen Schichten in Paris noch vermischt. Es war zwar viel vom Klassenkampf die Rede, aber die Klassen begegneten einander auf den Treppen und Treppenabsätzen und stießen sich mit dem Ellbogen. Miseria e nobiltà („Elend und Adel“), so lautet der Titel einer berühmten neapolitanischen Komödie. In Paris fand ich, der aus dem aristokratischen und plebejischen Neapel kam, diese Überlagerung zweier Extreme wieder.
Wir, die rebellierenden Studenten, ähnelten oft Amphibien, halb privilegiert, halb dem Hungertod nahe. Das Studium an der Sorbonne und das billige Essen in der Universitätsmensa waren ein von der Aureole der Boheme umkränztes Privileg. Das Elend der Boheme, eine twilight zone am ungesicherten Rand eines Abgrunds, die den Glanz kreativer Berufe, die wir neidvoll beäugten, von der grimmigen Tristesse endgültiger, dauernder Armut trennte. Viele von uns, die in solch luxuriöser Armut schwelgten, balancierten Seiltänzern gleich auf dem schmalen Grat dahin, und manchmal konnte einem schwindlig werden!
Daß ich damals im Mai auf der Cité wohnte, war nicht unproblematisch. Kam ich nachts aus einer Versammlung oder aus einem Restaurant im Quartier Latin, wußte ich nicht, wie ich nach Hause kommen sollte: Die Polizei umklammerte le Quartier – so hieß es – im Zangengriff. Man gelangte nur mit der Metro hinein und heraus, aber die fuhr ab einer gewissen Zeit nicht mehr. Also mußte ich zu Fuß westwärts zur Rive Gauche laufen, bis ans Ende des Polizeikordons, und dann den umgekehrten Weg am rechten Seineufer zurück, um zu meiner Insel an der anderen Uferseite zu gelangen. Wunderschön waren diese Nächte im Mai! Auf der einen Seite ein Quartier Latin mit aufgerissenem Pflaster, dunkel wegen der vielen kaputten Laternen, erfüllt vom Gestank nach Pulver und Tränengas, durchzogen von Schreien und Polizeisirenen; und auf der anderen Seite wie eh und je die majestätische, ruhige Stadt, deren Lichter sich im Wasser des Flusses spiegelten. Auf der einen Seite das Fieber meiner Jugend, auf der anderen die kühle Ruhe einer Kapitale, die viel gesehen hat. Glücklich und müde genoß ich diesen glitzernden Gegensatz zwischen dem lärmenden Geschehen und dem dreisten Fortbestand der Dinge.
Damals genoß Paris nicht nur bei Italienern ein Prestige, von dem heute nur Reste übrig sind. Noch war die französische Kultur nicht von der anglo-amerikanischen Hegemonie in die Ecke gedrängt worden. Paris wurde geschätzt, nicht nur als Weltstadt der Mode, der Küche und des Parfüms, sondern auch als kulturelle Supermacht. Wenn in Italien jemand aus der bürgerlichen Mittelschicht eine Fremdsprache sprach, dann gewöhnlich Französisch. Meine Mutter teilte ihren Freundinnen in Neapel damals strahlend mit: „Mein Sohn studiert in der Hauptstadt der Welt!“ Es stimmt, daß vor allem London und Amsterdam die umherziehende, alternative Jugendkultur – Beatniks, Hippies, Provos, Langhaarige usw. – anzog, aber Paris war ein Wallfahrtsort für alles, was sich für jung und alt als die andere Hochkultur darstellte. Frankreich verkaufte seine Massenkultur, die auch die hochgebildeten Eliten beflügelte, damals noch gut – und anders, als viele naive Intellektuelle glauben, schließen sich Kulturindustrie einerseits und das Maximum an Vollkommenheit und Qualität nicht aus, sondern gehören zusammen. In alle Welt exportierte Frankreich damals Claude Lévi-Strauss’ Anthropologie und die Asterix-Comics, Roland Barthes’ kritische Essays und die Chansons von Gainsbourg und Bécaud, Michel Foucaults Wahnsinn und Gesellschaft und die Filme von Claude Lelouch, Godards Kino und Zizi Jeanmaires Beine, die Zeitschrift Tel Quel und die Schlager von Françoise Hardy, die Lacansche Psychoanalyse und die Filme mit Louis de Funès … Heute exportiert Frankreich fast keine Massenkultur mehr, ausgenommen vielleicht Carla Bruni, und die Pariser Hochkultur ist leider nicht mehr das, was sie war. In Paris zu leben bedeutete für mich mageren, ehrgeizigen, blassen Jungen schon fast ein Leben in der Mitte des Sternenkreises, und ich fühlte mich so, wie sich der junge Alkibiades in Athen zur Zeit des Sokrates gefühlt haben muß.
Die Franzosen waren damals weniger aufgeblasen als heute, dafür produzierten sie Ideen, von denen wir alle beeindruckt waren. Diese Vorrangstellung von Paris auf dem Gebiet der Humanwissenschaften – Soziologie, Psychoanalyse, Essayistik, Anthropologie, Literaturkritik – währte die siebziger Jahre hindurch. Das gleiche gilt für die Linke. Meist waren die Gurus der Protestkultur Europäer wie Sartre, Russell, Foucault, Fortini, Adorno, Marcuse, Enzensberger, Colletti. Heute sind sie alle Amerikaner, Noam Chomsky, Jeremy Rifkin, Naomi Klein, Joseph Stiglitz zum Beispiel … Heute kritisiert man Amerika mit Worten und Begriffen, die uns die Amerikaner liefern.
Eine Vorliebe für Frankreich hegen viele von uns nach wie vor, weil es historisch in der Lage war, erfreuliche Ausnahmen statt Regeln hervorzubringen. Nicht zufällig ist heute von der exception française die Rede. Auch die Französische Revolution blieb eine Ausnahme und wurde keine Regel. (Das ganze 19.Jahrhundert hindurch erlebte Frankreich eine lange Reihe von Revolutionen und Gegenrevolutionen und war damit gewiß kein Vorbild an Stabilität.) Die Regel setzten und setzen die anglo-amerikanischen Länder, und es ist die Stabilität der Regel, die auf Dauer die beständigere politische und kulturelle Macht verleiht.
Deshalb ziehen heute manche die „französische Linke“ vor: Im Grunde wollen sie, daß der Sozialismus eine Aus-nahme ist und nicht die Regel. Die kurze Pariser Kommune erscheint in gutem Licht, die siebzig Jahre Sowjetsozialismus wecken Abscheu. Wenn aus der Revolution ein Regime wird, schlagen die dionysischen Revolutionäre – meistens Intellektuelle – den melancholischen Weg eines Majakowski ein. Wie auch immer, viele Linke wollen, daß der Sozialismus ein verspieltes Fest, daß er „französisch“ bleibe. Ein jedes schöne Spiel währt indes nur kurz. Und das war es, was mich recht schnell von ’68 wegführte: Das Fest war zwar schön, aber das Leben, hélas, war nicht die Fortsetzung dieses Festes in Ewigkeit. Wir wollten, daß es niemals endet! Aber es hatte ein Ende, und außerdem endet ja alles einmal: die Revolution, die Liebe, die Jugend und die Hoffnung, alles.
(...)