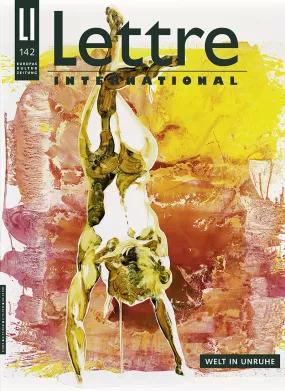LI 86, Herbst 2009
Tokio... Paris... Berlin...
Der beiläufige Raum. Unterwegs zu einer Stadt jenseits der StadtElementardaten
Textauszug
In den vergangenen 18 Jahren habe ich in drei Städten gelebt. Es gab Durchhänger, Zeiten, in denen ich mich nicht wohl gefühlt und das meiner Umgebung zugeschrieben habe. Aber im großen und ganzen hat mir dieses Leben gefallen. Ich habe sieben Jahre in Tokio verbracht, sechs in Paris, und seit sechs Jahren lebe und arbeite ich in Berlin. Es ist dann unvermeidlich, sich nach den Unterschieden zwischen den Städten zu fragen. Gespräche kreisen häufig um das Fremde: „Was unterscheidet Berlin von Paris? Was unterscheidet Berlin von Tokio?“
Offensichtlich bin ich nicht der erste, dem die ungenaue Neugierde an der Stadt auffällt, die sich bei solchen Fragen ja nur am Oberflächlichen festmachen kann. Sollte ich also berichten, daß es in Japan Erdbeben gibt oder in Frankreich Rotwein? „Es wäre wichtig zu wissen, warum man sich bei einer roten Nase ganz ungenau damit begnügt, sie sei rot … wogegen man bei etwas so Verwickeltem, wie es eine Stadt ist, in der man sich aufhält, immer durchaus genau wissen möchte, welche besondere Stadt das sei. Es lenkt von Wichtigerem ab.“ Eine Stadt ist eine Stadt – zumal da, wo ich gelebt habe und wo ich jetzt lebe. Es lohnt nicht, über ihre Unterschiede zu sprechen. Es lohnt aber wohl zu beschreiben, was mich in der einen Stadt an die andere erinnert. Denn nicht der Unterschied, sondern ihre Ähnlichkeit überrascht mich.
Ich berichte über Städte, die entwickelt sind. In diesen Städten gibt es nicht das Heer der rechtlosen Wanderarbeiter, das heute über die chinesischen oder indischen Metropolen hinwegfegt; da sind nicht mehr die unkontrollierten Bewegungen, wenn die Städte jede Nacht um zehntausend Menschen wachsen. Das sind nicht die Städte, in denen die Menschen in der Kanalisation leben, in denen sich Slums, Bidonvilles oder Marginalsiedlungen die Hänge entlangziehen … Ich habe in Städten gelebt, die anders funktionieren. Es sind ruhige Städte. Sie bewegen sich nicht wirklich. Früher – vielleicht war es ja vor vielen Jahren hier ganz ähnlich wie heute in Mumbai oder Shenzhen? „Bringen Sie mir dieses Bordell in Ordnung“, soll Charles de Gaulle zu Paul Delouvrier gesagt haben, als sie im Hubschrauber über Paris flogen. Danach erst entstanden neue Infrastrukturen und Ordnungssysteme: Ein rasantes Wachstum hatte 15 Jahre nach dem Krieg die Stadt auch hier an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Aber das ist lange her. Vielleicht sind diese Städte jetzt ja ausgewachsen? Verwundert betrachte ich heute die gefüllten Regale der Supermärkte, die Tankstellen, in denen das Benzin niemals knapp wird, oder die Busse, die an den Haltestellen vorfahren: beiläufige Städte, Städte mit Routinen.
Meine Sichtweise orientiert sich am Alltag. Das mag aus der Faszination für das Funktionieren der Stadt herrühren, die ich erst verstehe, wenn ich sie in Gebrauch nehme. Es interessiert mich, wie sich das Zusammenleben vieler Menschen auf begrenztem Raum organisiert, wie es sich fortentwickelt und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Selbstverständlich sind die Dinge mitunter nicht perfekt, und vielleicht lassen sie sich verbessern. Aber die Art und Weise, wie die Siedlungsflächen der Städte im Alltag kleingearbeitet werden, wie die einzelnen Räder ineinandergreifen, vermittelt mir ungleich stärker den Eindruck von der Stabilität der Umgebung, von ihrer Dauerhaftigkeit, als ein Monument oder eine Fassade. Denn es gibt Dinge, die in all den Städten, in denen ich gelebt habe, gleich sind. Orte und Situationen und Verhaltensweisen, die ich immer wieder finden konnte. Wiederholungen durchziehen sie wie ein starker Rhythmus, und etwas Vertrautes findet sich darin. Es gibt in ihnen Selbstverständlichkeiten, über die nicht mehr nachgedacht wird. Der Takt der U-Bahnen, an dem sich die Frequenz der Fußgänger auf der Straße orientiert. Die Schulen, an denen sich das Sortiment der kleinen Verkaufsläden und die Lage der kieferorthopädischen Praxen ausrichten. Und natürlich gibt es den Laden mit dem frischen Obst vor einem Altenheim, in dem mir ein strahlender Verkäufer erzählt, daß dies ein phantastischer Standort sei, weil die Senioren Hunger auf Kirschen haben. Eine Variation der stetigen Rhythmen kann vielleicht eine starke Wirkung entfalten. Es ist eine Arbeit am Alltag. Sie kann dazu führen, daß Städte sich in der Folge verändern.
Denn ich habe immer den Eindruck gehabt, daß sich die Städte aus der Normalität zusammensetzen. Es gibt Dinge im Alltag, die verhindern, daß sie auseinanderfallen. Parks zum Beispiel. Der Berliner Tiergarten findet sein Pendant im Yoyogipark oder an den Ufern des Sumidagawa, er findet Parallelen im Bois de Boulogne, im Bois de Vincennes oder auf den Terrassen von Saint-Denis. Vielleicht ist der eine Park wilder als der andere, vielleicht kleiner, vielleicht unterscheiden sich die Entstehungsgeschichten. Das ändert jedoch nichts an der Aufgabe, die die Vegetationsintarsien heute haben. Die Dichte einer Stadt wird für ihre Bewohner durch grüne Ausgleichsflächen erträglich gestaltet. In Tokio haben wir Drachen steigen lassen und die Kinder haben Fahrradfahren gelernt. Wir sind zu den Brunnen in den Tuilerien zum Zeitungslesen gegangen, und wir waren im Bois de Boulogne oder auf dem Marsfeld Joggen. Und wir haben mit anderen Eltern zum Abschluß des Schuljahrs im Tiergarten gegrillt. Es ist unvorstellbar, daß diese Flächen anders verwendet werden, verkauft oder zu Bauland umgewidmet werden, und es gibt viele nachvollziehbare Gründe, warum das richtig ist. Diese Grünflächen haben eine wichtige Bedeutung für den Luftaustausch einer Großstadt und haben eine soziale Funktion. Und sie sind so etwas wie das Gedächtnis einer Stadt. Diese Flächen sind stabiler und verläßlicher als die meisten anderen Orte, die ich kenne. Zerstörung oder Zerfall gehen an ihnen vorüber. Sie tauchen schon sehr früh in Stadtgrundrissen auf, und sie werden lange bestehen.
Oder Milchtüten. Die Erfindung des Tetra Paks ist großartig. Eine Flüssigkeit in einen Pappziegel zu pressen, der sich durch Hochklappen einer Ecke in eine Kanne verwandelt, das ist eine starke Idee. Sie hatte Erfolg, weil sie den Transport eines Produkts erleichtert. Und gleichzeitig wird die Verschmutzung während des Abfüllvorgangs vermieden. Milchtüten sind überall gleich. So wie Bahnlinien: Über lange Jahre hinweg habe ich Karten und Fahrpläne gesammelt, Diagramme des öffentlichen Verkehrs. Wenn ich eine möglichst direkte Verbindung suche, wenn ich die farbigen Linien mit den Fingern entlangfahre und die Stationen zähle, wenn ich versuche, meinen Zeitaufwand zu berechnen, um von A nach B zu kommen, dann verstehe ich sehr schnell, wie die Stadt funktioniert. Und ich verstehe, wie in einer bestimmten Situation vielfältige Interessen ineinandergreifen und sich fortschreiben und wie neue Ansätze gesucht werden, die mit dem bereits Vorgefundenen zusammenhängen. Dem radikal Neuen stehe ich zögernd gegenüber, wenn ich es mit solch einer Dimension zu tun habe. Manchmal sind die Dinge viel einfacher und gleichzeitig viel schwerer, als ich es mir vorstellen kann. Ich nutze den öffentlichen Verkehr, und ich gehe zu Fuß: Genau an den Schnittstellen ist das Nachdenken wichtig, dort, wo sich Bewegungen berühren. Ein unerhörter Designfortschritt war in Tokio die Entwicklung größerer Türen für die überfüllten Waggons der Metrolinien. Wenn die Züge einfahren, können sie nun fast die Hälfte ihrer Flanken öffnen, um die Passagiere zu entlassen. So konnte die Taktfrequenz der Züge erhöht werden. Die Bahnsteige mußten nicht verlängert werden, und wertvoller Raum konnte anders genutzt werden. Das ist eine spannende Lösung. Vielleicht liegt in der Interessenüberlagerung ein Ansatz für eine Stadt in der Zukunft, wenn sie fraglos anderen, nachhaltigen Prinzipien folgen muß.
(...)