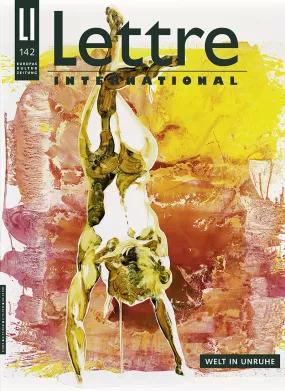LI 91, Winter 2010
Ein britischer Gauguin
Das abenteuerliche Leben des nahezu unbekannten Malers Ian FairweatherElementardaten
Genre: Porträt
Übersetzung: Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Textauszug
(Auszug/LI 91)
Eines Abends im April des Jahres 1952 kletterte unweit von Darwin ein seltsamer, scheuer, sechzigjähriger Mann mit kultivierter Stimme und blaßblauen Augen auf ein aus abgeworfenen Treibstofftanks gebautes Floß, um sich hinaus in die Timorsee treiben zu lassen. Er hatte einen Sack mit Trockenbrot dabei, das für zehn Tage reichen sollte, und einen Kompaß im Wert von dreißig Schilling. Schon nach wenigen Minuten drang das Wasser durch die Planken. Etwa eine Woche später wurde er nach erfolglosen Suchflügen für tot erklärt, und in den Zeitungen Großbritanniens und Australiens erschien ein Nachruf auf Ian Fairweather.
Zumindest Australiern ist seine Geschichte so bekannt wie ein alter Schlapphut. Er war Brite, der jüngste Sohn eines renommierten Sanitätsinspekteurs der indischen Armee, und wuchs auf Jersey in einem großen Haus mit Butler auf. Als Student der Londoner Slade School of Fine Arts gewann er diverse Preise und lernte Augustus John kennen, Somerset Maugham und den Polarforscher Robert Scott – dessen Bruder sich mit seiner Schwester Queenie verlobte. Mit Walter Sickert machte er in London eine erfolgreiche Ausstellung, und eines seiner Bilder hing in der Tate Gallery. Bis zum Tag seines Verschwindens lebte er in gauguinhaftem Elend im Heck eines ramponierten Patrouillenbootes. Ortsansässige in Darwin nannten ihn nicht ohne Häme einen „Achterstevenadmiral“.
„Wäre er auf seinem Floß gestorben – wozu nicht viel gefehlt hat“, schreibt Murray Bail, dessen jüngst erschienenes Buch über Fairweather das Ergebnis von fast vier Jahrzehnten geduldiger detektivischer Kleinarbeit ist, „wäre sein Name heute nur eine nette, kleine Fußnote: ein Postimpressionist mit chinesischen Anklängen bei den von ihm so bezeichneten ‘Touristenbildern’.“
Doch Fairweather war nicht gestorben. Nach 16 Tagen auf hoher See wurde er an Land gespült und überlebte, zutiefst verändert von dieser fast selbstmörderischen Fahrt, um einer der angesehensten australischen Künstler seines Jahrhunderts zu werden, vergleichbar vielleicht mit dem Nobelpreisträger Patrick White, dem Fairweather seinerseits in dessen Engagement für die Kunst ein Vorbild war. Zehn Jahre nachdem man Fairweather lebend geborgen hatte, stellte sich Robert Hughes, Kritiker des Time Magazine, eine ganze Nacht lang vor Sydneys Macquarie Galleries an, um eines seiner „Postfloßbilder“ kaufen zu können. „An die emotionale Bandbreite und atemberaubende Schönheit“, schrieb Hughes über Ephiphany, eines von Fairweathers Bildern, „scheint mir kein anderes australisches Bild heranzureichen.“ Bail geht in seiner Biographie/Monographie sogar noch weiter: „Es gibt nichts Vergleichbares in der Kunst Australiens – oder sonst eines Landes.“
1951, ein Jahr vor Ian Fairweathers mysteriöser Seereise, kam Sir Sidney Nolan nach Großbritannien und ließ sich dort nieder bis zu seinem Tod vierzig Jahre später. Die meisten gebildeten Engländer haben vom urbanen Nolan gehört, dem australischen Künstler und Schöpfer der emblematischen Ned-Kelly-Serie. („Sir Ned Kelly“ nannte ihn Patrick White.) Von Fairweather läßt sich dies nicht behaupten: ein britischer Maler von gewiß größerer Tiefe und Bedeutung, der vier oder fünf Sprachen beherrschte, sich aber, belesen und gelehrt, wie er war, für fast den gleichen Zeitraum vorwiegend im australischen Busch verkroch und dessen Kunstrichtungen aus Ost und West einendes Werk eine Brücke zwischen den beiden sich stetig annähernden Kulturen schlägt. Bail schreibt: „Infolge der Verschwiegenheit und Distanziertheit auf seiten Fairweathers weiß die Welt bis heute kaum von seiner Existenz.“
(...) Er wurde 1891 in Schottland geboren – in jenem Jahr, in dem Gauguin auf Tahiti landete –; das jüngste von neun Kindern. Seine einsame Kindheit läßt an Kipling, Saki und Somerset Maugham denken, die alle von steifen, knöchernen Fremden aufgezogen wurden. Er war sechs Monate alt, als sein Vater vom Maharadscha von Kapurthala als dessen Berater in medizinischen Angelegenheiten nach Indien berufen wurde. Nur ungern ließen seine Eltern den Jungen in der Obhut von zwei frommen Tanten zurück, zwei alkoholkranken Jungfern. Erst mit neun Jahren sollte er seine Mutter wieder zu Gesicht bekommen.
Die Tanten nahmen ihn mit nach Brechin, Sydenham und Jersey. Vermutlich mußte er denselben traumatischen Vorfall über sich ergehen lassen wie seine Geschwister. Eines Morgens, erzählt Geoffrey, glaubten die Tanten, das Ende der Welt nahe, und zogen den Kindern Sonntagskleider an. „Die Vorhänge wurden zugezogen, und sie mußten auf das Ende der Welt warten, aber es ist nicht gekommen.“ Als eine der Tanten auf Jersey beschwipst aus dem Fenster fiel, zwang Ians Mutter ihn, an den Sarg zu treten und sich die Leiche anzusehen.
1901 kehrten seine Eltern aus Indien zurück und nahmen ihn mit nach Forest Hill, doch schenkte man Ian dort nur wenig Aufmerksamkeit; insbesondere seine Mutter vernachlässigte ihn, eine unverantwortliche, extravagante Frau, die ein Vermögen für Hüte ausgab. „Sie wirkte immer ein wenig erstaunt und verschreckt“, erinnert er sich, „wie ein seltsamer Vogel, der ins Zimmer geflattert kam.“ Seine besten Freunde auf Jersey waren Raben, die ihm auf dem Kopf hockten und mit dem Schnabel Narben in die Kopfhaut meißelten. Mit zehn Jahren rannte er hinaus auf die Felsen und blieb die ganze Nacht auf einer Landzunge, die bei Flut vom Festland abgeschnitten war: Er wolle wissen, wie es ist, allein auf einer verlassenen Insel zu sein, erklärte er. Inseln, Isolation, Flucht – er steckte bereits seine Themen ab. Eines seiner Lieblingsbücher war Pan von Knut Hamsun, das ihn veranlaßte, einen Winter in Norwegen zu verbringen. „Ich kann die ersten Zeilen auf Norwegisch noch immer auswendig. Übersetzt lauten sie: ‘Ich sitze hier und denke an den Nordlandsommer, an eine Hütte, in der ich wohnte, und an den Wald hinter der Hütte’.“
Sein Vater drängte ihn, zur Armee zu gehen. Australische Buschfeuer sollten ihn später an das Inferno von Löwen erinnern. In Berichten erwähnt er, daß er am 22. August 1914 in Mons eine der letzten Kavallerieattacken der Geschichte miterlebt hatte. Zwei Tage später wurde er mit seinem gesamten Regiment gefangengenommen und verbrachte den Rest des Kriegs als Gefangener, obwohl ihm dreimal die Flucht gelang. „Ich habe es sogar bis zur Grenze geschafft und sah nur wenige hundert Schritte entfernt die Freiheit, aber es hat nicht geklappt.“ Sein „Job“ war es, Karten zu zeichnen und aus russischen Mänteln deutsche Uniformen zu nähen, von denen er sich eine zur Tarnung anzog, als er aus dem Lager in Freiberg spazierte und vorgab, einer Entwässerungskommission anzugehören. Seine beiden Mitflüchtlinge haben uns folgendes Bild von Fairweather hinterlassen: „Mein Bruder und ich sahen ihn – trotz der Uniform eine seltsam erbärmliche Gestalt – in ein dichtes Maisfeld am Wegrand krauchen, und dann verschwanden wir, so schnell wir konnten.“
Als man ihn wieder einmal aufgriff, wurde er zur Einzelhaft in einen „Käfig“ gesteckt. Drei Wochen ohne Nahrung, zur Stärkung nur der Geruch von frischem Brot von einer nahen Bäckerei. Seine Familie nahm an, daß ihn diese Erfahrung aus dem Gleichgewicht gebracht hat.
„Er ist ein schwieriger Mensch und kaum zu begreifen“, schreibt Bail. „Ich verstehe ihn jedenfalls nicht. Vielleicht hat damals eine vom Krieg ausgelöste Schizophrenie eingesetzt.“ Fairweather sah das anders: „Ich glaube, jene Jahre als Kriegsgefangener waren die glücklichste Zeit meines Lebens – keine Verantwortung für praktische Dinge wie Geld, Essen oder ein Dach über dem Kopf und endlos Zeit, das zu tun, was ich gern tat.“ Im Gefängnis hatte er nämlich angefangen zu zeichnen.
Kaum war der Krieg vorbei, schrieb sich Fairweather an der Kunsthochschule Slade ein und studierte Malerei unter Henry Tonks, der ihn „zutiefst melancholisch“ fand. Er war 37 Jahre alt, als, wie er bekannte, „meine Welt zusammenbrach“. Es war das Jahr 1928, und seine künstlerische Karriere lief ins Leere. „Meine Familie hatte genug von mir. Sie zahlte mich aus, zumindest sah ich es so.“ Man gab ihm einhundert Pfund und kaufte ihm die einfache Überfahrt nach Kanada, wo er armen Präriebauern half, das Korn einzubringen. „Ich muß aus dem Kornspeicher stehlen und kaue zwischendurch immer wieder Weizenkörner“, schrieb er seinem geduldigen Freund Jim Ede, der Sammler wie Eddy Sackville-West drängte, ein Bild von Fairweather zu kaufen. „Meine Leute rühren keinen Finger, wenn es um Kunst geht.“ (Als er zehn Jahre später in einem verlassenen Kino in Brisbane lebte und alte Plakate als Staffelei nutzte, schickte ihm seine Mutter dreißig Pfund, die er nur mit „Bauchschmerzen“ annahm. Sie schrieb: „Mein Lieber, was ist schon ein Kino gegen ein gesundes, ehrliches Leben?“) Seiner Familie überdrüssig, bekannte er Ede: „Obwohl ich eines Tages nach Hause zurückkehren will, möchte ich doch nicht, daß sie noch irgend etwas von mir erfährt.“ Gleichsam an Eltern statt schickte ihm Ede einen Malkasten. Der erreichte Fairweather auf einer Insel vor Vancouver, auf der er sich um das Landgut eines abwesenden Grundbesitzers kümmerte. „Ich bin ganz allein auf dieser Insel“, schrieb er.
Dann folgende Ankündigung: „Ich baue mir ein Floß aus Treibholz.“ Und später: „Manchmal wünschte ich mir, ich wäre geblieben.“ Geoffrey liest diesen letzten Satz noch einmal und lacht. „Das schreibt er im nachhinein; ihm hat es da gegen Ende gar nicht mehr gefallen – er zerstritt sich mit dem Grundbesitzer, einem ziemlichen Blödmann, der ihn auch nicht bezahlt hat, aber im nachhinein verklärt er die Zeit. Irgend etwas ging immer schief, und dann ist er weiter-gezogen.“
Fairweathers nächstes Reiseziel war Geoffreys Elternhaus in Victoria.
(...)