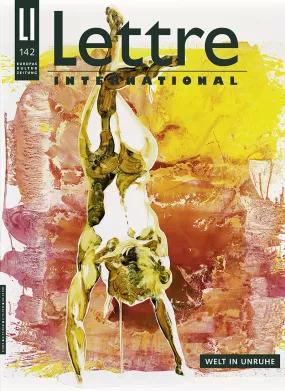LI 49, Sommer 2000
Bucht der Tiger
Angola sehen und überleben - Stimmen aus dem Staub des KriegesElementardaten
Genre: Bericht / Report
Übersetzung: Aus dem Portugiesischen von Inés Koebel
Textauszug
In jedem Millimeter dieses Bodens lauert der letzte Augenblick meines Lebens. So weit das Auge reicht. Deshalb fahren sie mich auch immer nachts. Um mich zu schützen. Es soll mir recht sein. Auch jetzt ist Nacht, und zwar reichlich. Und nachts bin ich immer unruhig. Meine Angst ist weg, desertiert. Zum Terrain geworden. Keine Solidarität, nichts. Nichts, woran ich mich klammern kann. Das kann tödlich sein. Der Boden, die Straße, die Savanne, das Land: Die Angst ist eine Landkarte, und wir müssen uns daran halten. Wir fahren mitten hindurch, und es ist Nacht. Ich weiß nicht, wie viele Tagesreisen es dauert. Durch die Nacht fahren ist alles, was mir bleibt.
Außerdem friere ich, bin müde und vollkommen ruhig. Später komme ich noch auf eine kleine Kiste zu sprechen, mit Wein, Tee und Salz. Und dann ist da auch diese wunderbare Kassette von Marilyn Monroe, mit einem kleinen Auftritt von Billie Holiday kurz vor Ende der Show.
In Menongue hat mir der Chef des Minenräumprojekts von Care in Cuando Cubango eine Karte der Provinz gezeigt, in detailliertem Maßstab. Sie hat die ganze Wand eingenommen. Ein Mosaik aus aneinandergeklebten Militärkarten, über und über mit roten Stecknadeln gespickt. Auch Rechtecke waren daraufgezeichnet, in der gleichen Farbe. Und blaue Fähnchen, fast alle im Umkreis von Menongue und an einem der Ufer längs des Cuebe, ein paar Zentimeter südöstlich.
- Die roten Rechtecke bedeuten Minenfelder. Aber das sind nicht alle, es gibt sehr viel mehr. Sie sehen hier nur die, die wir ausfindig gemacht haben. Die Rechtecke bedeuten strategische Punkte, um die man einen Minengürtel gelegt hat, wie um die Kasernen, die Munitionsdepots und den Flughafen. Die blauen Fähnchen bedeuten entminte Gelände. Seit Juni haben wir allein in diesem Gebiet 24.000 Sprengkörper entfernt. Wir lagern sie in einer Kaserne, einem ehemaligen kubanischen Versorgungsstützpunkt, gleich hinter der katholischen Mission. Später zerstören wir sie dann, wie kürzlich erst: 3.000 am Freitag und 680 am Samstag. Und dann die privaten Munitionsdepots, ein Wahnsinn. Dieser Tage haben uns Leute geholt, die ihr Haus gerade wieder aufbauen, die Maurer waren beim Ausheben im Garten auf 82 Mörser gestoßen. Man weiß ja nie, wann man sie brauchen kann ...
Vom Bié aus führt eine einzige blaue Linie nach Menongue. Und zwei kurze Stichstraßen, die eine in südlicher Richtung bis Caiundo und die andere nach Osten bis Cuíto Canavale. Die einzigen Verbindungswege über Land, auf einer Fläche größer als Portugal.
- Und dieses blaue Rechteck, am Flußufer?
- Das ist der Badestrand rechterhand des Staudamms. Dort gehen die Soldaten der UNAVEM immer hin. Das andere Ufer ist nach wie vor vermint. Sie schwimmen nur bis zur Mitte.
- Und wo ist die Straße hinter Caiundo, Richtung Jamba?
- Die gibt es nicht.
- Die in Luanda meinten aber vielleicht doch.
- Da ist keine Straße, und der Rest, der ist vermint. Bis Caiundo haben wir die Asphaltstrecke entminen können. Das ist alles. Auf den Seitenstreifen wird es schon wieder gefährlich. Vor einiger Zeit hat sich dort ein Unfall ereignet, mit einem Lastwagen, der zurücksetzen wollte. Es gab Tote, Leute, die auf der Ladefläche mitfuhren, wie es hier üblich ist. Unterhalb von Caiundo sind die Minenfelder noch nicht einmal lokalisiert worden. Die UNITA und die Regierung haben uns keine Karten gegeben. Kein Mensch fährt auf dieser Straße, selbst die Panzerwagen der UNAVEM nicht.
- Und wie bewegen sich die NROs fort, die dort sind?
- Dort unten sind keine NROs. Da ist kein Mensch! Der größte Teil dieser Provinz ist nie erkundet worden, es hat dort kaum Aufklärungsmissionen der UNO gegeben. Hab’ ich mich verständlich ausgedrückt?
- Aber ich wollte auf diesem Weg nach Sambia. Über Jamba. Es gibt keine andere Verbindung.
- Ich sag’ Ihnen doch, da ist keine Straße! Niemand darf weiter als bis Caiundo. Kehren Sie um, nehmen Sie ein Flugzeug nach Luanda und von dort eins nach Sambia, wenn die Sache für Sie so wichtig ist.
Am Eingang des Büros der Leute von Care stehen einige Bambusregale mit verschiedenen Typen von Minen und Sprengkörpern, alle in der Stadt gefunden. Minen aus Rußland, Kuba, Südafrika und China. Einige tragen vom Hersteller eingravierte Gebrauchsanweisungen, damit auch ja nichts schiefgeht: "Diese Seite auf den Feind richten". Am gefährlichsten sind die chinesischen Plastikminen.
- Ich fahre bis Caiundo. Ich versuche durchzukommen.
- In drei Tagen sind Sie wieder zurück und sagen mir, daß ich Recht hatte. Und wenn nicht, das können Sie mir glauben, dann, weil Sie tot sind. Wie auch immer, das Flugzeug nach Luanda wird Sie mitnehmen, so oder so. Dann bis in drei Tagen. Und machen Sie uns keinen Arger, kommen Sie auf Ihren eigenen Füßen zurück.
Ich hab’ ihn nicht wieder gesehen. Oben an der Straße liegt der Bahnhof, ohne einen einzigen Zug; im Krieg kamen sie aus Namibe und Lubango, und mit ihnen Munition und Massaker. Unten ist der Fluß, und kurz davor: das Ende der Welt, eine Diskothek. Geschlossen, wahrscheinlich Bankrott, mangels Bedarf. Ich bin los, nach unten.
Der letzte Augenblick also. Durch die Nacht. Keine Landschaft, keine Dörfer, keine Menschen um Feuerstellen, keine Elefanten vor dem Aschgrau des Himmels. Ich hatte erwartet, ich könnte von solchen Dingen erzählen, aber es wäre gelogen. Kein Horizont, nichts zeichnet sich ab, keine Zeit, keine Richtung. Alles reduziert sich auf eine zweigeteilte Windschutzscheibe. Wir fahren auf eine Schar gespenstischer Wesen zu. Sie leuchten im Lichtstrahl der Scheinwerfer auf, und fallen wieder zurück ins Dunkel, wenn wir unter ohrenbetäubendem Motorenlärm über sie weg fahren. Büsche, Kaninchen, Fledermäuse, Wiegenlieder, ein Zoo voller Erinnerungen.
Unser Schiff ist ein Kamaz. Sowjetisches Fabrikat.
Sie haben so gewaltige Fahrzeuge hergestellt: ein Kiel mit Vierradantrieb (jedes Rad mannshoch), um den rebellischen Sand zu durchpflügen, die weiten Ebenen, die brückenlosen Flüsse von Cuando Cubango.
Die rechte Tür ist ohne Scheibe. Und wir spüren es. Der Kamaz stürzt sich mitten in die Kälte und die Vegetation, blindlings, wie ein Büffel, schlägt plötzlich um sich, teilt wilde Stöße aus. Seit Stunden kämpfen wir gegen ein Gewirr aus gigantischen Disteln. Bäume beinahe. Biegsam, aber zäh. Sie locken uns in den Hinterhalt, so kommt es mir vor, schlagen mit brutaler Kraft über dem Laster zusammen, wie Wellen bei einem Unwetter. Dornen, hart, stahlhart. Es hagelt Peitschenhiebe von allen Seiten, als die Stoßstange ihnen das Kreuz bricht bis runter zur Wurzel und wir sie hinter uns lassen und sie wie Nägel über das Fahrgestell kratzen, das Blech. Sie stekken das Führerhaus und meine Füße in Brand. Nach und nach zerreißen die Disteln meinen Jackenärmel, fallen dann auf die Straße (ich sehe sie in einer Spiegelscherbe). Sie sind mir ins Fleisch gedrungen, haben flüchtig mein Ohr erwischt; sie geht mir an den Kragen, diese Messerflora. Ohne meine Kapuze: nicht auszudenken.
Der Oberstleutnant sitzt in der Mitte und schläft seinen Patentschlaf. Ich beneide ihn, er macht sich immer breiter, drängt mich an den Rand, zu den Disteln hin, ich verpaß’ ihm einen Rippenstoß. Eher ein Reflex als eine bewußte Verteidigung, ich spüre meinen Körper kaum noch.
Vor zwei, drei oder vielleicht auch vier Tagen, es spielt keine Rolle, mußten wir den Motor ausbauen. Wir fuhren in einem Jeep mitten durch vermintes Gelände zwischen Caiundo und Cuangar. Der Jeep mitten im Sand, der Motor in Einzelteilen mitten im Sand, zwei Rebellen mit ölverschmierten Armen im Sand und Sand im Öl. Ein ganzer Tag, um den Motor zu reinigen. Und der Oberstleutnant raucht und erzählt mir von damals, als er auf eine Mine getreten war. Er spürt den Klick unter der Fußsohle, erstarrt. Heult laut auf. Sie sollen ihn wegholen. Eine alte portugiesische Mine. Bei denen dauert es nach dem Klick eine einzige Sekunde, und sie gehen hoch. Der Klick aktiviert die Mine. Die Explosion erfolgt, wenn der Druck von oben nachläßt. Verzweiflung und Überlebenswille haben nur die restliche Sekunde zu Verfügung. Der Oberstleutnant verlangt ein Stück Holz, sie werfen es ihm zu. Schweißüberströmt schiebt er das Holz vorn unter den Stiefel, übt so Druck auf die Mine aus und schafft es, seinen Fuß zurückzuziehen, noch bevor sie explodiert. Wirft sich bäuchlings auf den Boden. Die Mine geht hinter ihm hoch. Er steht mehrere Tage unter Schock. Das ist alles. Wir beide betrachten seine beiden Füße. Sie sind unversehrt. Wir bekommen Hunger. Suchen ein paar Zweige zusammen. Balancieren dazu auf den parallel verlaufenden Spuren des Jeeps und kochen uns anschließend einen Topf Tee. Ich reiche den kleinen weißen Beutel weiter, den ich in Menongue bekommen habe, wir nehmen uns Zucker. Der Oberstleutnant schlürft einen Schluck, spuckt aus. Im Beutel ist Salz.
Alle zwanzig Minuten wird ein Mensch durch eine Antipersonenmine getötet oder verstümmelt. In der Erde von siebzig Ländern liegen mehr als hundert Millionen Minen. Ungefähr ein Zehntel davon in Angola. In Cuando Cubango, wo sich schätzungsweise 45 Prozent aller angolanischen Minen befinden, gibt es mehr Minen als Einwohner. Es haben dort nie viele Menschen gelebt, und in den letzten Jahren haben von den wenigen viele den Tod gefunden.
Durch das scheibenlose Rückfenster des Kamaz gellen über unsere Ohren und den peinigenden Lärm hinweg die Anweisungen des Kopiloten. Ein UNITA-Rebell, der seinen Kopf wie ein Beduine mit einem Fetzen verhüllt hat.
- Bei dem Baum dort nach links ... Nach links. Dann nach rechts ... Im Wald geradeaus ... Nach rechts, durch den Sand durch ... Nach rechts! Rrrr-eee-chch-tssss!!! Stopp! Mist! Zurück, mach schon! Jetzt hier lang, da drüben.
Nehmen wir an, der Kopilot kennt die Gegend.
Nehmen wir an, hinter seiner jungen Maske verbirgt sich das Gesicht eines Kriegsveteranen.
- Links!
Gehen wir davon aus, daß er die Minenfelder kennt, schließlich hat er sie mit gelegt.
Hoffen wir, daß er nicht zum ersten Mal querfeldein durch dieses Gelände fährt – anders geht es ja nicht.
- Links!
Hoffen wir, daß er schon einmal bei Nacht gefahren ist.
- Rechts!
Vertrauen wir darauf, daß er weder sich noch uns umbringen will. Gehen wir davon aus, daß er diesen natürlichen Reflex nicht hat (warum eigentlich nicht?), nicht einmal für einen Bruchteil dieser Nacht, in der es nie Tag wird.
- Wir sind da! Aufwachen!
Ich war nur still gewesen. Meine Lider sind bleischwer, und in meinem Hirn zuckt ein Nordlicht.
- Ich hab’ kein Auge zugetan. Hast du gemerkt, daß sie uns die ganze Zeit beobachtet haben?
An allen Ecken und Enden ein Brummen, das offenbar nicht vom Motor kam, "Diese Seite auf den Feind richten".
Dirico heißt das hier auf der Karte, aber wo sind wir wirklich? Das Ziel ist eine veränderliche Koordinate. Gestern erst war mein Geburtstag, er kann unmöglich schon wieder vorbei sein. Ich springe aus dem Kamaz, meine Hände sind blaurot vor Kälte, ich schaffe es gerade noch, in zwei Luftspiegelungen zu taumeln: ein Haus in Trümmern und ein Fluß am Ende der Ebene. Von dieser Wasservision auf dem kalten Zement träume ich jetzt, halte den Traum mit den Händen fest: meine Füße zu Stein erstarrt, aber unversehrt.
"Marylin". Diese schaurig schönen Flugzeugbomben, die mir ein portugiesischer Offizier zeigt, bevor sie vernichtet werden. Zwei Meter lange glänzende Zylinder, die nicht explodiert sind im hohen Gras von Menongue. Beschmiert mit "Je t’aime Brigitte!"
Auf der anderen Seite des Flusses, wo die Ebene sich fortsetzt, südwärts, ein gutes Stück über Dirico hinaus, das in Trümmern liegt, und wo das Wasser auf wundersame Weise in Kraftstrom übergeht, ist ein Mann. Ein Mann in Namibia, auf der stummen Kehrseite seines Lebens. Noch kenne ich ihn nicht, er sitzt im Schatten. Trägt kurze Hosen. Ich werde ihn sehr viel später treffen, auf meinem Weg, und immer am Fluß, diesen Mann, den ich noch nicht kenne und der jetzt dort lebt. Zwischen Mehlsäcken und Öl, und mit Habichtsaugen in einen Krieg eintauchend, der ihn töten gelehrt hat, nicht aber die Freude am Töten.
Der Mann steht auf.
John van der Merwe war ein ungewöhnlicher Soldat der südafrikanischen Streitkräfte, die 1975 in Angola einfielen. Unter seinem Kommando fegte – ein Wort, das er gern gebraucht – ein Bataillon angolanischer bushmen, die Flechas Negras [Schwarze Pfeile], gemeinsam mit dem Bataillon Búfalo [Büffel], die Truppen Agostinho Netos und Fidel Castros vor sich her, von Cuando Cubango bis Cuanza Norte. John van der Merwes militärische Laufbahn hatte kurz vor der Invasion begonnen, im Februar des gleichen Jahres: Stützpunkt Omega, Caprivizipfel, Südwestafrika. Nach einem neuntägigen Aufenthalt in Pretoria, im Hotel Metropol, nach einem Gespräch mit einem Apartheid-General, dem Schöpfer des John van der Merwe.
Auf Anweisung dieses Generals gab man ihm vier Uniformen, eine Pistole und einen Fahrer bis Omega, dort rekrutierte die südafrikanische Armee, einschließlich einiger portugiesischer Militärs und Siedler, die Flechas und die Búfalos und bildete sie aus. Als erstes beauftragte man John van der Merwe, die bushmen einzusammeln, die aus Angola geflohen waren und verstreut am rechten Ufer des Cubango/Okavango lebten. Vorzügliche Spurensucher, schlaue Kämpfer, extrem widerstandsfähige Männer. Schon die PIDE hatte diese Buschmänner – in zahlreichen Militärbasen zum Aufspüren von Rebellen ausgebildet – weiträumig eingesetzt.
- Angolaner, älter als das schwarze Volk Angolas, ohne Dörfer, Leute aus dem Busch, die mal hier, mal da essen.
In Omega wurden die bushmen in zwei Kompanien zusammengefaßt. Ihre erste Kampfhandlung auf dem Kriegsschauplatz war ein Gefecht mit der SWAPO, dort, wo sich heute Jamba befindet, in der angolanischen Grenzregion von Luiana und Nambangando. Kurz darauf folgte die Operation Sabena: ein tollkühner Vormarsch nach Norden, Richtung Luanda.
- Wir haben alles weggefegt, von Dirico bis Serpa Pinto und von Serpa Pinto bis Pereira d’Eça, wo wir zum ersten Mal Mann gegen Mann mit der MPLA gekämpft haben, das war vom 12. bis zum 14. August 1975.
John van der Merwe betont immer wieder, Pretoria hätte ursprünglich nicht die Absicht gehabt, in Angola einzumarschieren, sondern hätte nur die Grenze zu seiner südwestafrikanischen Kolonie säubern wollen.
- Die Kubaner waren Schuld an dem ganzen Schlamassel, die reinste Provokation, sie haben uns gezwungen, zurückzuschlagen. Wenn es darum gegangen wäre, Angola wegzufegen, hätten wir das in zwei, maximal vier Wochen geschafft.
Südafrika aber wollte nicht einmarschieren. Oder wollte nicht, daß die Welt erfuhr, daß es bereits einmarschiert war. Die Flechas und die Búfalos besetzten eine Stadt und zogen sich anschließend vier, fünf Tage in den Busch zurück, ehe es weiterging, von Überfall zu Überfall, von Ortschaft zu Ortschaft, von Zerstörung zu Zerstörung. Und das drei Monate lang, bis Novo Redondo. John van der Merwe erinnert sich: viel Feigheit, jede Menge Bremsklötze. Pretoria wollte und wollte wieder nicht, während die Militärs vorwärts drängten. In dieser ganzen Zeit verlor Van der Merwe nur zwei Männer.
- Und einen durch einen Unfall. Ich war damals Feldwebel.
Seine hundertsechzig bushmen (und fünf in die südafrikanische Kommandostruktur integrierte Portugiesen) bildeten die Angriffskraft. Die Búfalos, die achthundert Mann zählende Besatzungskraft, erntete, obgleich sie erst später hinzustieß, die Lorbeeren des Feldzugs, was sich insofern verstehen läßt, als der Oberbefehlshaber beider Kräfte, Oberst Bretemburg, der Gründer des Bataillons war.
Am Unabhängigkeitstag Angolas, dem 11. November, befand sich John van der Merve in Novo Redondo, konnte aber keine Pontons Richtung Norden über den Fluß legen, da das Gefecht nur hundert Meter von der zerstörten Brücke entfernt stattfand und keine Pioniereinheit unter solchen Umständen effizient arbeiten kann. Fünf MIGs flogen an diesem Tag im Tiefflug über ihre Köpfe hinweg die Küste entlang, allerdings ohne Bomben abzuwerfen. Den Flechas gelang es nicht, mit einem Konvoi von achtundzwanzig Lastwagen die Stromschnellen im Randgebiet von Cuanza Norte zu passieren, und in der Serra da Gabela setzten ihnen die FAPLA höllisch mit ihren 122-Millimeter-Geschützen zu. Doch zusätzlich zu dieser aus der "vereinten Kraft" FNLA/UNITA bestehenden Kampffront stieß im Osten eine Einheit "bereits weißer Südafrikaner", Richtung Hauptstadt vor. Und von Norden her die FNLA unter Holden Roberto bis nach Catete.
- Wir hatten Luanda schon in der Zange. Haben den Krieg in Catete aber verloren. Wenn man eine Stadt einnehmen will, braucht man Deckung durch die Artillerie, aber Holden Roberto wollte keine Opfer unter Kindern und Unschuldigen und weigerte sich, Luanda unter Beschuß zu nehmen. Von dem Augenblick an, als die Schwarzen sich einmischten, gab es Interessenkonflikte und ein Riesendurcheinander. Der südafrikanische General geriet dermaßen in Rage, daß er den nächstbesten Hubschrauber nach Uíge genommen hat und von dort aus nach Südafrika zurück ist. Auf seinen Befehl hin wurde die Operation schließlich eingestellt.
Lauter Fakten in John van der Merwes Kopf. Ebenso wie die Geschichte, daß sich Agostinho Neto und andere hohe Politiker vor dem unmittelbar bevorstehenden Fall Luandas fünfzehn Meilen außerhalb der Stadt in Sicherheit gebracht hätten. Desgleichen steht für ihn fest, daß der Krieg bereits wegen der Amerikaner verloren war, den geheimen Drahtziehern der Operation Sabena, die durch ihre Unentschlossenheit, "zu einem Zeitpunkt, als Tag und Nacht Kubaner nach Angola eindrangen", angeblich wichtige Zeit vertaten. Breschnew und Kissinger, ein Abkommen, zwei Rückzüge, und die Sache wäre erledigt gewesen.
Die Kolonne der bushmen stieß am 21. Dezember von Novo Redondo aus in See, abgelöst von weißen Soldaten (bei den Flechas alles in allem nicht mehr als zwanzig, bis hinunter zum Feldwebel: Offiziere, Kampfwagenfahrer, Sanitäts- und Nachschubpersonal ...), und Weihnachten wurde in der Etappe verbracht. John van der Merwe sollte am 5. Januar wieder nach Angola an die Front, zu diesem Zeitpunkt aber befanden sich die Truppen Pretorias bereits auf dem Rückzug.
- Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war. In Angola hat sich die Lage seither jedenfalls nicht mehr stabilisiert. So gesehen war es also schlecht.
Südafrikas Niederlage brachte zudem das Scheitern eines anderen Vorhabens mit sich: der Übergabe des neuen Angola an Holden Roberto und die Zerschlagung der UNITA, denn
- die FNLA vertrat eine vollkommen andere Ideologie: sie wollte, daß die Weißen weiterhin im Land blieben; sie wollte zwar an die Regierung, aber die Weißen sollten deshalb nicht gehen. Das hat die FNLA wiederholt deutlich gemacht. Wo die UNITA auftauchte, wurde gemordet, geplündert und geraubt. Die Massaker der UPA, das war ganz am Anfang, 1961, aber damals war Jonas Savimbi auch noch mit Holden Roberto zusammen ...
John van der Merwe und seine Männer kehrten am 5. Januar 1976 in den Caprivizipfel zurück. Er wurde zum Oberfeldwebel des Bataillons ernannt und befehligte die Flechas bis 1978 auf dem Stützpunkt Omega, als "RSM" und mit Kommando- und Disziplinargewalt. Dies bedeutete drei Jahre lang Militäreinsätze gegen die SWAPO, wohlgemerkt nie gemeinsam mit der UNITA und niemals auf namibischem Gebiet – "hier bei uns hat es nicht einen Hinterhalt, nicht eine Rebellen-Mine gegeben". Die Flechas wurden in Westsambia eingesetzt – in der Anfangsphase unterhielt die SWAPO Stützpunkte auf einigen der Inseln im Rio Cuando, in der Sambesiebene – und in Angola, "ganz tief in Angola". Eines der wichtigsten Ausbildungslager der SWAPO befand sich in Henrique de Carvalho, zweitausend Kilometer vom Caprivizipfel entfernt! John van der Merwe war als RSM eigentlich Standortkommandant, nahm aber selbst an vielen Einsätzen teil, da
- meine Männer mich gern bei den Einsätzen dabei hatten und mich sogar darum baten. Selbst Offiziere, die ganze Kompanien befehligten, fühlten sich sicherer, wenn ich mit von der Partie war: Es gab ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, nach dem Motto: Entweder alle gehen drauf oder keiner!
1978 hatte er die Nase voll. Er bat um seine Versetzung nach Pretoria und wechselte nach einem neunmonatigen Fachlehrgang von der Infanterie zu den Pionieren. Mit dem Resultat, daß er wieder zurück nach Omega kam: Seit drei Jahren baute man dort an einer Landepiste, und die Armee benötigte jemanden, der in der Lage war, die Arbeiten abzuschließen. Nach nur neun Wochen stieg John van der Merwe, ursprünglich als Mechaniker gekommen, gemeinsam mit einem Ingenieur und einem Topographen zum Leiter der Einheit auf und stellte eintausenddreihundert Meter Rollfeld so weit fertig, daß es asphaltiert werden konnte.
Er fand zwar "Geschmack an der Sache", blieb aber nicht lange bei den Pionieren. John van der Merwe wurde von seinem ehemaligen Kommandanten, General Zangos, kontaktiert und aufgefordert, oder "fast gezwungen", den Rekies beizutreten, der Elite unter den südafrikanischen Elitetruppen. Eine sechsmonatige Ausbildung für vierhundert Mann, ausgewählt aus einer Heerschar von zweihunderttausend: Von den fünf oder sechs, die das Rennen machten, war jeder einzelne eine Kriegsmaschine.
Die Rekies hatten aufgrund der neuen Militärpolitik Pretorias mit der Rekrutierung von Búfalos begonnen:
- Die Afrikaner haben eine andere Taktik als die Europäer. Der Schwarze paßt sich leichter an, ist zäher. Er braucht keine Nahrung und kein Wasser. Er kämpft zwar nicht besser – weil ein Schwarzer ohne einen Weißen nämlich keinen Finger rührt, wozu auch – aber er kennt das Gelände, und wenn er einem Weißen traut, dann setzt er sich voll und ganz ein.
Die Rekies wollten, daß John van der Merwe zwischen Südafrikanern und Búfalos dolmetschte und sich um sie und ihre Familien kümmerte: um ärztliche Versorgung, um Medikamente und Verpflegung sowie um ihre militärische Ausbildung und Wagen mit zivilen Nummernschildern für den Transport innerhalb Südafrikas usw. (er sollte vor allem gewährleisten, daß während der Fahrten nicht gesprochen wurde). Doch das war es nicht, was John van der Merwe wollte.
- Ich hab’ das Handtuch geworfen, na ja, nicht ganz. Ich hab’ dem Kommandanten gesagt, ich wollte weiterkommen. Andernfalls würd’ ich mich wieder zurückmelden, zu den Pionieren.
Van der Merwe dachte an die Fallschirmjäger. Die Südafrikaner setzen ihre Fallschirmjäger als Aufklärungskommandos ein. Angenommen, zwei Männer werden vierzig Kilometer von Luanda entfernt während der Nacht abgesetzt und müssen die Mission allein ausführen, Pretoria die gewünschte Information liefern, wo die und die Raffinerie liegt, wie sie arbeitet, wie viele Soldaten dort stationiert sind und welche Art Waffen sie benutzen; sie müssen es herausfinden, um jeden Preis; anschließend ein vereinbarter Treffpunkt zu einer vereinbarten Zeit, und der Rückzug in einem Schlauchboot oder einem Unterseeboot, das heimlich in der Ferne wartet ...
Doch Van der Merwe wollte nicht zu den Aufklärern, sondern zu den Unterstützungseinheiten. Angenommen, es gilt das Hauptquartier in Luanda anzugreifen; oder jemanden aus einem Gefängnis der angolanischen Hauptstadt zu "befreien"; wann immer, auch jetzt, wenn nötig, springen die Rekies aus einer Höhe von fünfunddreißigtausend Fuß, damit das Flugzeug nicht auf dem Radarschirm erscheint; so hoch oben tragen alle, Springer wie Flieger, Sauerstoffmasken, weil der Absprung aus einer Höhe geschieht, in der es kein Leben gibt; wer springt, weiß, daß er in einem Umkreis von dreißig Kilometern ankommt, direkt ins Zielgebiet – es sei denn, er hat das Pech, mitten in einer feindlichen Kaserne zu landen, was so gut wie nie passiert, da man im allgemeinen unbewohnte Gegenden auswählt und dort oft schon ein heimlich eingedrungener Kommandotrupp wartet ...
- Ich bin viel gesprungen.
John van der Merwe war von November 1978 bis 1983 bei den Rekies. Dann wollte er weg, es war nicht einfach, schließlich bekam er die Erlaubnis, nach Windhoek zu wechseln (wo er vor seiner Zeit in Durban schon einmal kurz stationiert gewesen war), und zwar wieder als RSM, im Baubataillon des South West Africa Engeneer Regiment [SWAER]. Es war sozusagen sein erster Schritt aus dem aktiven Dienst. Ein Jahr später ging er zurück ins Zivilleben. Hätte Pretoria seine rechtliche Situation nicht schamlos ausgenutzt, wäre dies bereits früher geschehen. Erst 1984, auf ein harsches Schreiben an die südafrikanische Regierung, erhielt John van der Merwe die Aufenthaltsgenehmigung für die Kolonie Südwestafrika. Das war im Januar, im August schied der Fallschirmjäger aus der Armee aus.
- Ich kann sagen: Ich wurde zu diesem Leben gezwungen. Aber ich habe immer für etwas Besseres gekämpft und hatte viel Erfolg. Ich bin oft dekoriert worden. Die von der Armee haben mich schon dreimal aufgefordert, wieder zu ihnen zu kommen.
John van der Merwe war neun Jahre lang Handlanger Pieter Bothas, der mit seinem "Buschkrieg" eine gezielte Destabilisierungspolitik im südlichen Afrika betrieb. In seiner Erinnerung war die südafrikanische Armee unglaublich, ohnegleichen auf dem gesamten Kontinent. Eine beispielhafte Organisation, in der nichts schiefging und nichts fehlte: eine Armee, die um neun Uhr abends, wo auch immer sich ihre Leute befanden, mit einer Dakota erschien, Essen, Wasser und Zigaretten abwarf; eine Armee, die, sobald sie über Funk das SOS ihrer im angolanischen Landesinneren eingekesselten Kämpfer erhielt, auf der Stelle Flugzeuge losschickte und innerhalb weniger Minuten mit dem Feind aufräumte.
- Und zum Schluß sagten die Piloten immer: "If you need me again, call me, please!" die Piloten der Impalas, Kampfmaschinen, daß du nur so mit den Ohren schlackerst. Bildschöne Flugzeuge. Kaum sind sie in den Himmel entschwunden, rasieren sie auch schon im Tiefflug die Bäume ab. Reiben ganze Kolonnen auf.
John van der Merwe hat Dinge hinter sich, an die man sich nicht gleich erinnert. Die erste Geschichte, und am schwierigsten zu erzählen, ist die von dem Tag, als er eine entsicherte Granate an der Brust trug, denn falls er sterben mußte, wollte er sich wenigstens selbst umbringen.
Es war in Benguela, die sogenannte Vereinte Kraft hatte den Flughafen (ohne Widerstand) besetzt. Am Ende des Rollfelds befand und befindet sich wahrscheinlich noch immer, ein Fußballplatz, auf dem die südafrikanische Einheit ihr Lager aufschlug. Sie wurde am folgenden Tag überraschend von der FAPLA, den Kubanern und einer Verstärkung aus Novo Redondo angegriffen. Feuer von allen Seiten, über vierhundert Soldaten umzingelt. Sie hatten das Pech, ihre schwere Artillerie durch einen einzigen feindlichen Treffer zu verlieren, der den gesamten Mörserzug vernichtete – acht Mann starben, zwei davon waren auf der Stelle tot, die anderen schwer verletzt, die Geräte nicht mehr einsatzfähig. Trommelfeuer, das immer heftiger wurde, bis die FAPLA bemerkte, daß die südafrikanischen Mörser schwiegen. Einem Kommandotrupp gelang es, den Kessel zu durchbrechen, in einem Fahrzeug, dem vier Granaten nichts anhaben konnten; sie wollten Verstärkung holen – die Búfalos. John van der Merwe blieb mit den anderen zurück und hatte wie sie das Ende vor Augen.
- Die Lage war aussichtlos. Doch dann haben wir uns spontan entschlossen, die Typen einzeln, Mann gegen Mann, wegzufegen! Als sie uns kommen sahen, so ungeschützt, sind sie langsam zurückgewichen. Als ich die Granate in die Hand nahm, hab’ ich nur an Gott und an meine Familie gedacht. Mein letzter Tag. Wir waren, wie gesagt, alle bereit, hatten unsere Granaten, und wollten sie nur zünden, wenn die anderen uns zu nah kamen: Dann mußten wir zwar ins Gras beißen, aber der Feind mit uns. Also, ruhig Blut! Wir entsichern unsere Granaten und halten sie mit den Zündern immer schön dicht an die Brust. Und rufen uns zu: Ganz ruhig! die Typen haben die Hosen voll, ganz ruhig! Und plötzlich: feeeertig, los!!! Und wir raus aus der Dekkung, kaltblütig und wie Schlangen im Zickzack. Wir haben mehrere Dutzend über den Haufen gerannt, und sind durchgekommen. Aber viele sind auf der Stecke geblieben ...
Es war der 15. August 1975. Vielleicht der schlimmste von John van der Merwes letzten Tagen – andere verschweigt er vielleicht.
Es war das Ende!
- Ein Mörder war ich nicht, nein. Man darf nur töten, um sich zu verteidigen: darauf sind wir trainiert, das gehört zum Leben eines Mannes. Ich war einer, der im Kampf viele auf diesem Rücken hier getragen hat: Schwarze, Feinde, um sie zu retten. Ich hab’ viele gerettet. Es ging mir nie darum, andere aus dem Weg zu räumen. Deshalb hab’ ich die Sache auch nicht länger ausgehalten. Ich war nur leider gezwungen, so viele Jahre zu bleiben, sie haben mir ja nicht die nötigen Papiere gegeben ...Ich hab’ Trauriges durchgemacht. Aber töten aus Spaß, nein.
Da steht nun ein Mann aufrecht auf der anderen Seite des Flusses.
(...)