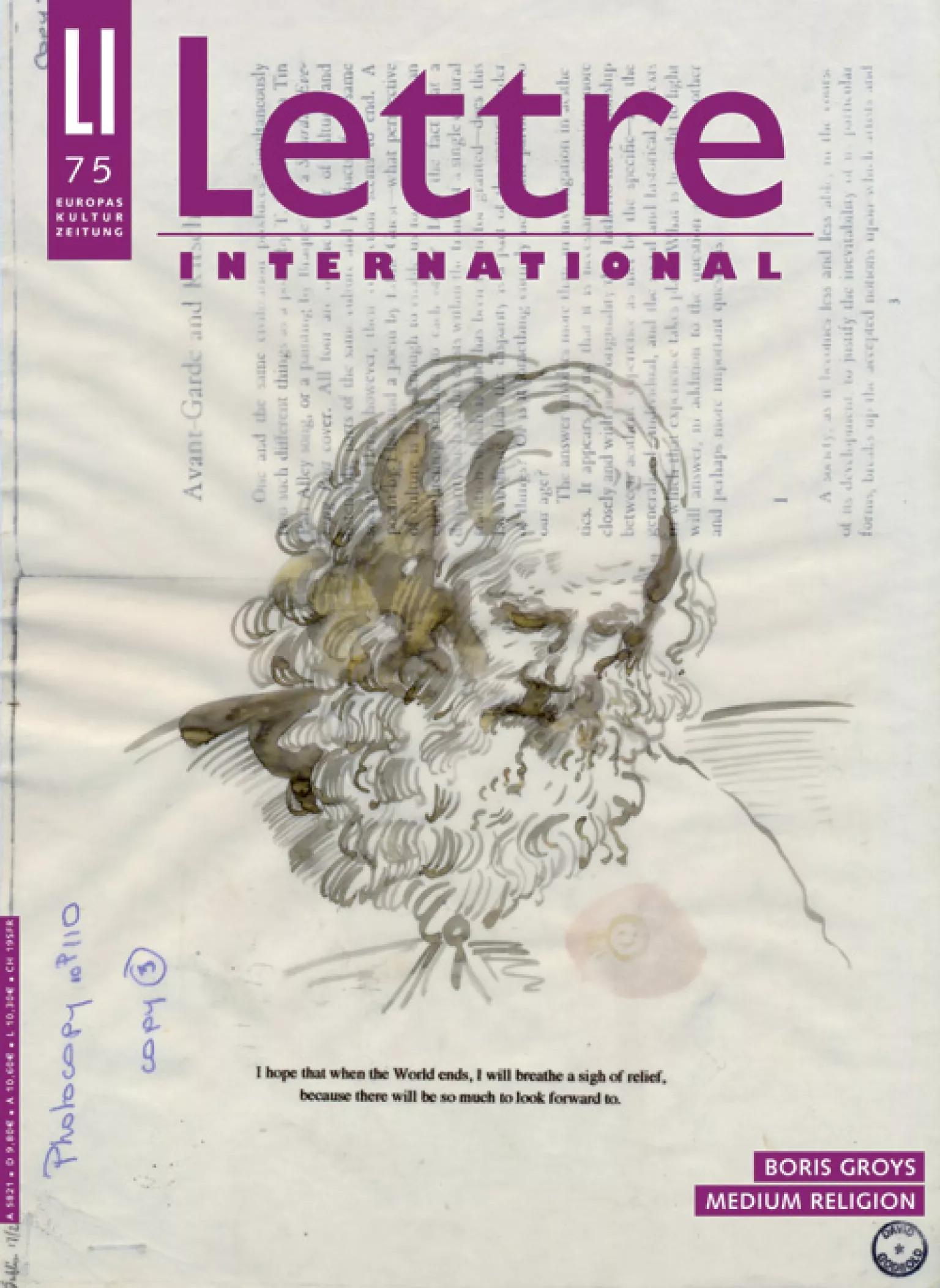LI 75, Winter 2006
Fälscher von Format
Vom Bedürfnis, betrogen zu werden, und der Kunst, es zu befriedigenElementardaten
Genre: Essay, Kriminalgeschichte, Recherche
Übersetzung: Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann
Textauszug
So wie die Wörter nicht die Dinge sind, ist die Kunst nicht das, was sie darstellt - hierin wirkt das ehrgeizige Streben aller "Realismen" naiv, seien sie nun sozialistisch oder nicht. Der Mensch denkt, redet, träumt, liebt nur über die Vermittlung einer Galaxie von Darstellungen, die sich verschachteln und überlagern, vor allem, wenn er Krieg führt. Auch das bedeutet der Mythos vom Sündenfall: Fern vom Paradies ist jeder unmittelbare Zugang zum Wahren verloren, außer vielleicht für die Wahn-sinnigen, die Mystiker, welche schweigsame Leute sind, und zuweilen die Kinder, wenn sie nichts sagen. So ist die Lage des Menschen, die Rimbaud in einer blitzartigen Erkenntnis zusammengefaßt hat: "Das wahre Leben ist anderswo." Diese Formulierung trifft jeden von uns im tiefsten Inneren, und ihre rätselhaften Nachwirkungen bleiben so lange bestehen, daß sich die Werbung und gewisse Parteien auf sie berufen haben und uns mit ihren Waren oder ihren Programmen versprechen, endlich das "wahre Leben" wiederzufinden. Man weiß ja, was bei einer derart schamlosen Wiederverwertung herauskommt. Wenigstens hat die Täuschung unfehlbar und ironisch bewiesen, wie richtig dieser Satz ist.
Man darf sich also im allgemeinen kein vorschnelles Bild vom Wahren und Falschen machen, als wären dies deutlich unterschiedene und sogar entgegengesetzte Kategorien. Statt dessen hat sich zum Beispiel die Kunst in vielen Epochen vorsätzlich und unverhohlen durch Nachahmung und Plagiat entwickelt, indem sie sich des trügerischen und falschen Scheins, der Anamorphosen und Schimären bediente, die manche Fürsten in ihren Kuriositätenkabinetten aufbewahrten. Die Kunst ahmt stets die Kunst nach.
Uns interessiert hier ein eng begrenzter Bereich: die absichtlichen Täuschungsmanöver geschickter Leute, die Nachahmungen wirklicher Objekte als echt ausgeben wollen, um daraus Nutzen zu ziehen. Die Tätigkeit der Fälscher wird durch Gesetze bestraft, selbst wenn sich deren Definition und das Strafmaß je nach Land und Gesetzbuch unterscheiden. Als der junge Schüler Giotto eine Fliege auf ein Bild seines Meisters Cimabue malte, um ihm seine Kunstfertigkeit zu beweisen, wie es Antonio Filarete in seinem Trattato di architettura (1461) erzählt, hat er gewiß eine Fälschung begangen: Der Meister glaubte kurze Zeit daran, und der Schüler zog daraus Nutzen: Sein Talent wurde anerkannt. Man gestattet einem Maler, in einem Museum ein Gemälde zu kopieren, unter der Bedingung, daß er von den Maßen des Originals deutlich abweicht. Wenn aber der Kopist seine Arbeit als das wirkliche Werk eines Meisters ausgibt und sie zu einem Preis verkauft, der dessen Marktwert entspricht, wird das Geschäft als rechtswidrig beurteilt.
Diese Antwort wirkt einfach. Tatsächlich ist sie kurz und knapp. Hat ein Maler das Recht, Fälschungen zu signieren, die man ihm aus Komplizenschaft oder Leichtfertigkeit zuschreibt, weil er das für vorteilhaft hält oder er sich nicht mehr erinnert, was er ein paar Jahre zuvor getan hat? Hat er das Recht, wie Dalí leere Blätter zu signieren? Und was soll man über einen Fälscher sagen, der keine vorhandenen Werke nachahmt, sondern andere schafft, etwa unbekannte Vermeers? Oder über jene russischen Künstler, die Mitte der achtziger Jahre in den Pariser Vororten eine angeblich vom kommunistischen Regime totgeschwiegene, neoimpressionistische Malerbewegung – die „Schule von Wladimir" – völlig frei erfanden? Oder über diejenigen, die andere, nämlich Sachverständige, über die Zuschreibung der von ihnen vorgestellten Gemälde entscheiden lassen, ohne sich selbst zu äußern? Wenn man einen Geldschein herstellt und dabei eine existierende Banknote nachahmt, ist das ein Verbrechen – doch worin liegt der Betrug, wenn es die Münze oder den Schein nicht gibt? Hierin besteht das Gleichnis vom Falschmünzer, der einen Zwölf-Euro-Schein in Umlauf bringen will und einen vorsichtigen Geschäftsmann um Kleingeld bittet, worauf dieser ihm antwortet: "Möchten Sie lieber drei Vier-Euro-Scheine oder zwei Sechs-Euro-Scheine?"
Manche fertigen nie gesehene Objekte an, die man sich aber vorstellt und herbeiwünscht, einen Drachen, eine Sirene, einen Außerirdischen. Sind sie nun Betrüger, oder betrügen sich die anderen selbst? Darf man sie bestrafen, wenn sie nichts beanspruchen? Wenn sie behaupten: "Das habe ich in meinem Garten gefunden, was mag das wohl sein?" Und wenn sich die anderen spontan auf per-sön-liche Spekulationen einlassen: Das sei der Knochen einer Dinosauriermutante, das fehlende Kettenglied zwischen dieser und jener Art und so weiter? Wer ist daran schuld? Nicht die Erfinder, sondern offensichtlich die Erklärer. Deshalb hüten sich kluge Psychoanalytiker, einen ihnen berichteten Traum zu deuten – einen Traum, den man im Wachzustand ersonnen oder den das hinterhältige Unbewußte im Schlaf gestaltet hat, um dem Analytiker zu gefallen –, und mit einer unwiderlegbaren Retourkutsche geben sie den Ball wieder an den Träumer zurück: "Und Sie, was halten Sie davon?"
Wie es der Philosoph Roger Pouivet in einer Studie über die Ontologie der Fälschung (L'Ontologie du faux, 2004) formuliert hat, ist es keine innere Eigenschaft eines Objektes, gefälscht zu sein: "Nichts ist eine Fälschung, so wie etwas ein Mensch oder eine Tulpe sein kann. In einer bestimmten wertenden Darstellung sind bestimmte Dinge falsch, denn sie lassen sich nicht der Person oder Institution zuschreiben, von denen man behauptet, daß sie sie getan oder geäußert haben. (...) Die Echtheit ist eine Sache der Identität. Die Identität ist in dem Sinne relativ, daß X an sich nicht echt oder falsch ist, vielmehr ist es ein echtes oder falsches Y. Wenn wir sagen, daß ein Bild, ein Paß oder eine Banknote gefälscht seien, erklären wir, daß sie, obwohl es nicht so scheint, nicht zu derselben Art wie etwas anderes – Z – gehören, das wirklich das Werk von Y ist."
(http://www.interdisciplines.org/artcognition/papers/2/language/fr)
Fälscher sind manchmal sympathische und oft amüsante Leute. Mit ein paar von ihnen habe ich mich beschäftigt, zudem auch mit einigen, die weniger zum Lachen sind. Denn das Reich der Fälschung umfaßt alles, wie das des Teufels, und obwohl Täuschungen nur Scherze oder Gaunereien sind, nur den Stolz oder den Geldbeutel verletzen, lassen manche Blut fließen. Die Propaganda nährt sich von Fälschungen; sie benutzt sie, um Kriege vorzubereiten oder zu rechtfertigen. Die schlimmsten subtilen und ungreifbaren Fälschungen führen den Verstand in die Irre. Dummheit ist kein harmloses Übel.
CESLAW BOJARSKI
Es war einmal in der Mitte des letzten Jahrhunderts, im Departement Seine-et-Oise, ein ruhiger, allgemein geachteter und verheirateter Mann, Vater von zwei Kindern, ein polnischer Flüchtling, der sich als Ceslaw Bojarski vorstellte – wenn er sich überhaupt vorstellte, denn er war zurückhaltend und ebenso unauffällig wie sein Häuschen in Montgeron. Außerdem reiste er meistens kreuz und quer durch Frankreich. Eine kleine Gestalt aus einem Roman Simenons, einer von diesen grauen Schatten, dessen Äußeres nichts von dem Abgrund in seinem Inneren verrät. Seine Nachbarn verstanden nicht, daß die Polizei am Anfang des Jahres 1964 einen solch ehrenwerten Bürger heimsuchen konnte.
Im Januar 1951 hatte die Bank von Frankreich gemeldet, daß in der Pariser Region falsche „blaue", beinahe makellose Tausend-Franc-Banknoten der Ausgabe von 1945 in Umlauf waren. Sie fielen nur durch winzige Kleinigkeiten auf, die gleichen, die wie ein Fingerabdruck wirkten und die man 1958 bei den ausgezeichneten, an verschiedenen Stellen des Landes auftauchenden Fälschungen des "Land und Meer" darstellenden Fünftausend-Franc-Scheins feststellte. 1964 kamen falsche neue Hundert-Franc-Noten mit dem Bild Bonapartes hinzu, und nun war man überzeugt, daß diese drei Fälschungen ein und denselben Urheber hatten. Ein einzelner falscher Bonaparte steckte gewöhnlich in einem Geldbündel, bis man eines Tages auf ein ganzes Bündel von zehn falschen Scheinen stieß, das jemand in der Post eingezahlt hatte, um Schatzanweisungen zu kaufen, und das in einem Büro des XVII. Arrondissements abgestempelt war. Ein verhängnisvoller Fehler. Ein erster Verdächtiger wird ermittelt und beschattet. Er führt zu einem zweiten, Schuwalow, einem Russen, der sehr enge Beziehungen zu seinem polnischen Schwager Dowgierd unterhält. Die beiden Männer werden wegen des Besitzes dieses Falschgelds festgenommen und geben schließlich den Namen Bojarskis preis – ihres alten Freundes, des führenden Kunstgenies.
Seine Familie sieht betroffen zu, wie man ihm Handschellen anlegt, und er protestiert entrüstet. Die Hausdurchsuchung dauert Stunden. Man entdeckt einen Tresor, der Schatzanweisungen über 72 Millionen enthält, aber nicht die Fälscherwerkstatt. Ein Inspektor gießt aus Versehen ein Getränk auf den Linoleumbelag des Bodens, der die Flüssigkeit sofort aufsaugt. Die Polizisten heben eine Falltür hoch, noch eine – dort kommt Bojarskis unterirdisches Versteck zum Vorschein, und der Mann legt in aller Ruhe ein Geständnis ab.
Jahrelang ist er im Nachtzug durch Frankreich gefahren, um seine Fälschungen abzusetzen, indem er hier und da ein paar Kleinigkeiten kaufte, ohne überhaupt in einem Hotel abzusteigen. Eines Tages bekam er diese Reisen satt und verkaufte Dowgierd ein Falschgeldpaket, wobei er ihm empfahl, gewissenhaft die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie er selbst zu beachten. Unter anderem dürfe er niemals eine Schatzanweisung bei der Post mit einer Blüte kaufen. Dowgierd und sein Schwager hatten es zu eilig und mißachteten seine Anweisung. Ein Stück Linoleum besiegelte nun seinen Fall. Der ehemalige Schüler des Institut Polytechnique erzählte den Polizisten nicht ohne Stolz und in schulmeisterlichem Ton, wie lange er sich in Geduld geübt habe; von seinen schlaflosen Nächten, seinen Kunstgriffen, seinen erstaunlich einfallsreichen handwerk-lichen Verfahren. Er hatte 300 Millionen alter Franc in zwölf Jahren allein hergestellt. Die Richter billigten ihm zwanzig Jahre hinter Gittern zu.
Wenn Bojarski immer noch unübertroffen im Pantheon der Falschmünzer thront, hat er gleichwohl nicht den Grundstein zu diesem Gebäude gelegt. Falschgeld ist eine logische Folge des Handels. Als der Tauschhandel durch den leichter und bequemer zu bewältigenden Austausch von Metallstücken aus Bronze, Silber oder Gold ersetzt wurde, bemühten sich entfernte Vorläufer des Polen, das eigentliche Symbol jedes Wertes nachzumachen: das Geld, dieses wunderbare Mittel, das nicht riecht, keine Spuren hinterläßt und in der Gesellschaft, in der es zirkuliert, wie etwas Flüssiges von Hand zu Hand rieselt. Viele Museen besitzen Exemplare aus der galloromanischen Periode, vor allem Asse aus Bronze. Bronze wurde als ein Edel-metall angesehen, weil die Metalle, aus denen sich diese Legierung zusammensetzt (Kupfer und Zinn), einen hohen Preis hatten und es schwierig war, sie zusammenzuschmelzen. Die Falschmünzer schmolzen lediglich billige Metalle, die sie mit einer Bronze- oder Silberschicht überzogen. Manche Kaufleute warfen die Münzen auf eine Waage, um sich das Zählen zu ersparen, und einige Fälscher, die es allzu eilig hatten, übersahen wohl dieses kleine Problem mit dem Gewicht. Ihre Ungeschicklichkeit machte die ehrlichen Leute mißtrauisch, und man gewöhnte es sich an, die Münzen einzukerben, indem man auf sie biß, um sich zu überzeugen, daß sie innen echt waren.
Hier müßte man sich in einer Abschweifung mit den Alchimisten beschäftigen, die während des ganzen Mittelalters nach dem Stein der Weisen suchten, der Blei in Gold umwandeln sollte, denn Gold übernahm sehr früh die Rolle einer höchsten Währung. Im 16. Jahrhundert trieben zwielichtige Gelehrte und alle möglichen Scharlatane ihr Unwesen in den winzigen Häuschen der Goldgasse im alten Prag. Rudolf II., der herrschende Kaiser, der sich für okkulte Wissenschaften begeisterte, war dermaßen darauf versessen, den sagenhaften Stein zu erwerben, daß er sich eines Tages von einem sehr hartnäckigen Abenteurer, dem Engländer Edward Kelley, prellen ließ. Diesem – einem auf Abwege geratenen Schüler John Dees - hatte man in England we-gen Urkundenfälschung beide Ohren abgeschnitten. Später war er nach Prag geflohen und verkündete, er könne Quecksilber in Gold verwandeln. Es gelang ihm glänzend, den Kaiser und seine Höflinge zu übertölpeln, allerdings nur ein einziges Mal. Er wurde geadelt und richtete sich in einem prächtigen Gebäude ein, das als „Faust-Haus" bekannt war. Doch als ihn der Kaiser drängte, konnte er seine Großtat nicht wiederholen, und Rudolf II. ließ ihn ins Gefängnis werfen und foltern. Kelley weigerte sich zu sprechen und entkam aus der Burg: Er kletterte an einem Strick hinab, der jedoch unglücklicherweise zerriß. Bei seinem Sturz brach er sich ein Bein, das man ihm amputieren mußte, sobald er wieder gefaßt war. Der sich auf eine Holzprothese stützende und begnadigte Alchimist lebte nun von Almosen und kam wegen Schulden ins Gefängnis zurück. Er wollte abermals mit einem schadhaften Strick entkommen und verlor dabei sein zweites Bein. Ruiniert, mit abgeschnittenen Ohren und amputierten Beinen, vergiftete sich der Mann, der behauptet hatte, Gold zu machen, nachdem er durch seinen Mut die Herzen der Prager gewonnen hatte.
(...)