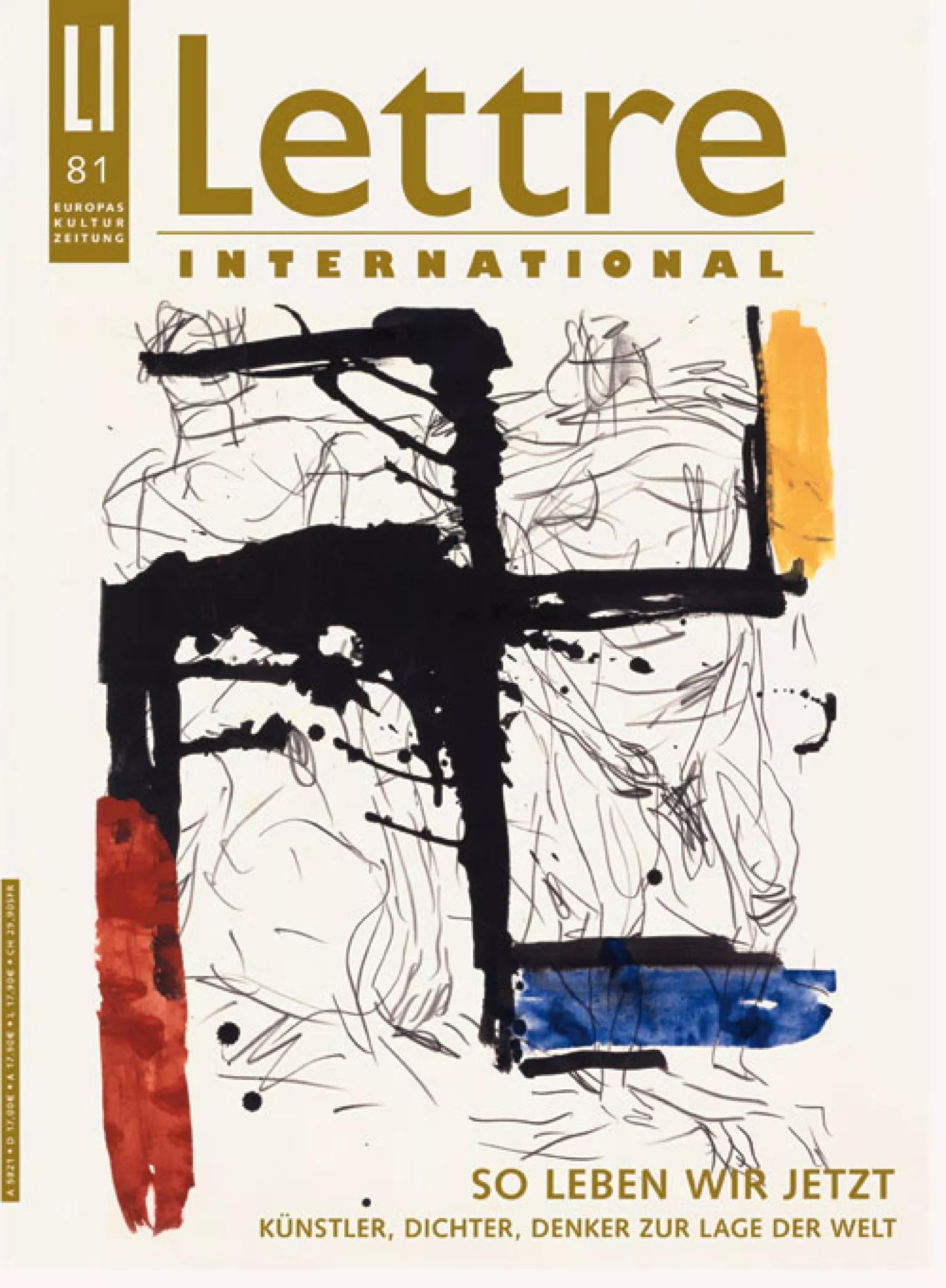LI 81, Sommer 2008
Geschichtsprognosen
Weltbürgerliche Absichten und die Weltregenten des EigennutzesElementardaten
Textauszug
Der Titel klang kompliziert: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Der Text war von vollkommener Durchsichtigkeit, bedächtig, pathoslos, das tiefe Ungenügen an Weltlauf und Weltzustand hinter einer Sachlichkeit verbergend, die der tiefste Ausdruck dieses Ungenügens war, mit Autorität argumentierend in einer Weise, daß deutlich wurde, wie der Autor um alles wußte, was seiner Idee entgegenstand, und sie doch als eine notwendige, ja zwangsläufige behauptend, wenn man der Menschheit denn eine Zukunft zuschreiben wolle, die der Beschaffenheit des Menschen als eines vernunftbegabten Naturwesens entspräche und ihn nicht bloß als das Ergebnis einer „zwecklos spielenden Natur“ ansehe oder gar „eines bösartigen Geistes“, der die Anordnung eines weisen Schöpfers „neidischer Weise verderbt habe“.
Es war eine Berliner Zeitschrift, die 1783 von zwei tatkräftigen Aufklärern gegründete und unter dem Schutz des preußischen Kultusministers von Zedlitz stehende Berlinische Monatsschrift, die diesen Text im Jahre 1784 ihrer über das ganze protestantische Deutschland verstreuten Leserschaft vorlegte. Der Autor war kein Berliner; er hatte die weltoffene Handelsstadt, an deren Universität er eine Professur bekleidete, nie verlassen und drei Jahre zuvor ein die europäische Philosophie umstürzendes Werk veröffentlicht, das die Aufklärung über sich selbst aufklärte und Kritik der reinen Vernunft hieß. Als Geschichtsphilosoph erwies dieser Untertan Friedrichs II. sich als nicht weniger revolutionär denn als Erkenntnistheoretiker: Die Rede ist von Immanuel Kant.
224 Jahre sind über diesen Text hingegangen und haben ihn nicht veralten lassen, so wenig wie einen ihm 14 Jahre später folgenden, der, fünf Jahre nach der Hinrichtung Ludwigs XVI., so weit ging, die selbstlose und riskante, also offenbar moralisch motivierte Anteilnahme des deutschen Publikums an der Behauptung der Volksrechte in der Französischen Revolution für ein Indiz, fast eine Gewähr dafür zu erklären, daß nicht nur im einzelnen Menschen, sondern in der Gattung, der Menschheit ein moralisches Bewußtsein am Werk sei, das auf ein „Fortschreiten zum Besseren“ in deren Gesamtorganisation nicht nur hoffen lasse, sondern es prognostizierbar mache. War Kant, der Widersacher aller Schwärmerei, Utopist? Er ist der wahre, der realistische Utopiker der deutschen Philosophie, einer, der sich und andern nicht zuviel verspricht, wenn er Indizien möglicher Besserung bemerkt. „Allmählich“, prognostiziert er, „wird der Gewalttätigkeit von Seiten der Mächtigen weniger, der Folgsamkeit in Ansehung der Gesetze mehr werden … ohne daß dabei die moralische Grundlage im Menschengeschlechte im mindesten vergrößert werden darf, als wozu auch eine Art von neuer Schöpfung (übernatürlicher Einfluß) erforderlich sein würde.“
Kant ist kein Prediger endzeitlicher Harmonie; er ist Anthropologe genug, um zu wissen, „daß die Masse des unserer Natur angearteten Guten und Bösen in der Anlage immer dieselbe bleibe“. Zugleich weiß er, daß der Mensch, um – das ist sein zentrales Kriterium – alle seine Naturanlagen zu entwickeln, eine Mischung von Eintracht und Zwietracht nötig hat, die er „die ungesellige Geselligkeit“ nennt. „Der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß besser, was für seine Gattung gut ist: sie will Zwietracht“, nämlich um ihn „aus der Lässigkeit und untätigen Genügsamkeit hinaus“ zu bringen und „in Arbeit und Mühseligkeiten“ zu stürzen. Die Lösung: eine Gesellschaft, „die die größte Freiheit, mithin einen durchgängigen Antagonism ihrer Glieder“ mit der „genausten Bestimmung und Sicherung der Grenzen dieser Freiheit“ verbindet, „damit sie mit der Freiheit anderer bestehen könne“. So und nur so könne „die höchste Absicht der Natur, nämlich die Entwickelung aller ihrer Anlagen, in der Menschheit erreicht werden“.
Auf dem Weg zu einer Freiheit und Ordnung dergestalt in ein dynamisches Gleichgewicht bringenden Gesellschaft (Kant nennt sie die bürgerliche, später die republikanische) erkennt der Autor zwei Probleme. Das eine nennt er „das schwerste, das, welches von der Menschengattung am spätesten aufgelöst wird“. Der Mensch sei „ein Tier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig hat, … der ihm den eigenen Willen breche und ihn nötige, einem allgemeingültigen Willen, dabei jeder frei sein kann, zu gehorchen“. „Wo nimmt er aber“, fragt sich der Autor, „diesen Herrn her? Nirgend anders als aus der Menschengattung. Aber dieser ist ebensowohl ein Tier, das einen Herrn nötig hat. Er mag es also anfangen, wie er will: so ist nicht abzusehen, wie er sich ein Oberhaupt der öffentlichen Gerechtigkeit verschaffen könne, das selbst gerecht sei“; dasselbe gelte für eine regierende Gruppe.
Kant setzt an dieser Stelle eine jener Fußnoten hinzu, die zu seinen kostbarsten Stilmitteln gehören: „Wenn wir aber diesen Auftrag der Natur gut ausrichten, so können wir uns wohl schmeicheln, daß wir unter unseren Nachbarn im Weltgebäude einen nicht geringen Rang behaupten dürften.“ Kein schlechter Ansporn zur Welteinrenkung: daß wir uns bei unsern Nachbarn in den Galaxien auszeichnen können. Aber die Voraussetzung ist nicht aufrechtzuerhalten: Wir haben keine Nachbarn in einem Weltgebäude, das von jeher und immer noch in detonativer Ausdehnung begriffen ist. Daß es diese Nachbarn geben könne, ist unwahrscheinlich in einem so horrenden Grad, daß die Einzigartigkeit des Menschen für wissenschaftlich erhärtet gelten kann. Um so dringlicher ist die Behebung der Diskrepanz, sagen wir ruhig: des antagonistischen Widerspruchs zwischen der offenbaren Gelungenheit des Einzelwesens und der Abwegigkeit der gesellschaftlichen Gesamtexistenz.
(…)