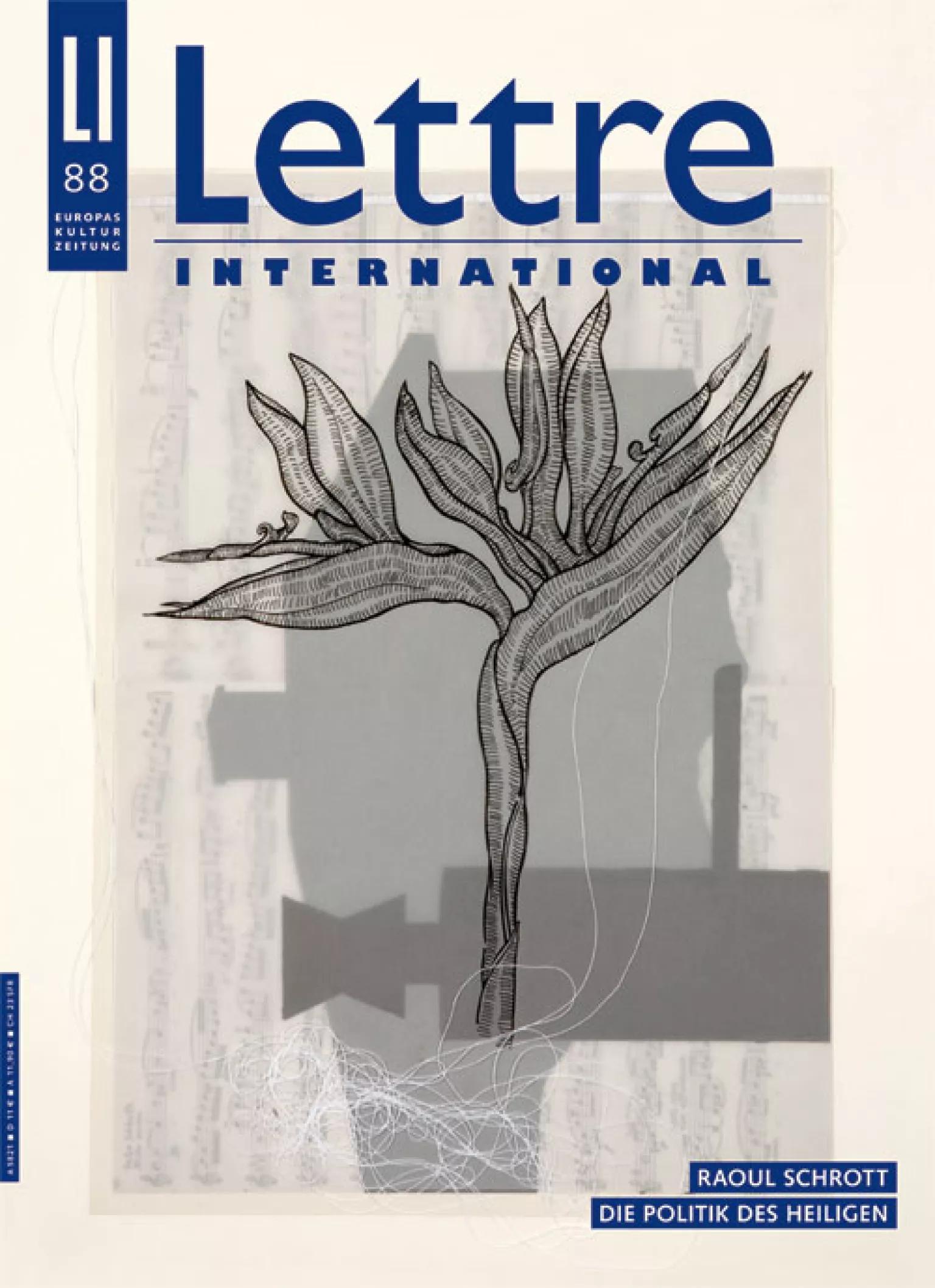LI 88, Frühjahr 2010
Haiti stirbt, Haiti lebt
Der Messias kehrte zurück, aber es half nichts. Port-au-Prince 1953-2008Elementardaten
Genre: Autobiographie, Landesporträt, Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Englischen von Uli Aumüller
Textauszug
Im Mai 2008 fuhr ich eines Abends nach Pétionville hinauf, um bei Jean-Claude Bajeux in der ersten bewachten Wohnanlage, die ich je in Haiti gesehen habe, Abend zu essen. Monsieur Bajeux, ein ehemaliger katholischer Priester, hatte Graham Greene in Haiti herumgeführt, wie ich es 1954 in Port-au-Prince mit ihm gemacht hatte. Jetzt wollte er eine Demonstration von Müttern gegen die grassierenden Entführungen und Morde organisieren, bei denen manchmal sogar Kinder gefoltert und vergewaltigt werden. Ich bezweifelte, daß sich die Täter von Frauen, die mit strenger Miene Spruchbänder wie „Mütter gegen Kidnapping“ hochhielten, zu Mitgefühl rühren lassen würden, aber er drückte eine schwache Hoffnung aus: „In Haiti sehen alle alles.“ Er zog sein Lid herunter. „Überall sind Augen. Es könnte sein, daß die Leute, die die Kidnapper decken, sich dann schämen.“
Kidnapping war früher so gut wie unbekannt. Eine landläufige Meinung besagt, der in Südafrika im Exil lebende Messias, „Titid“, Aristide, der ständig behauptet, er sei von der CIA, von Amerikanern und Franzosen „gekidnappt“ worden, lasse seinen Gefolgsleuten ausrichten, daß Kidnapping eine geeignete Rache und äußerst gewinnbringend sei. Wenn das auch nicht sehr logisch klingt, könnte es für seine früheren chimères und andere von zuviel Crack durchgeknallte, betrunkene, überhaupt hochaggressive Gangster doch eine Logik haben. Die Demonstration der Mütter gegen Kidnapping scheint allerdings wenig Aussicht auf Erfolg zu haben.
Das schon immer schwache soziale Gefüge ist zerbrochen. Expater Bajeux, mit einem Gewissen beladen, hofft noch immer, Seelen zu retten.
Staub und Rauch, Kummer und Leid vergiften die Luft von Port-au-Prince, die einst süß nach flammendroten Bougainvilleen, nach Bäumen voller Papayas und Mangos duftete, nach all den scharfen Gerüchen tropischer Fruchtbarkeit und Fäulnis. Die Stadt und die Nation waren arm, aber nicht hoffnungslos arm. Im Alter von zehn Jahren lief mein Sohn Ethan, freundlich begleitet von Gelächter, Geplauder und Neckereien, allein durch die Straßen. Der Rauch von Holzkohle bedeutete, daß Essen gekocht wurde. Eine schlanke Berkeley-Studentin, die ihren spirituellen Brüdern und Schwestern gern einen Rat geben wollte, bat mich, einer Mutter, die für ihre Kinder zum Frühstück Reis und Bohnen kochte, etwas auf Kreyòl zu sagen: „Sagen Sie ihr, daß sie es mit dem Kohlehydratanteil übertreibt.“
Reis und Bohnen liefern eine komplette Proteinmahlzeit, dear Lady. In Berkeley übertreibt ihr es mit dem Tofu- und Sushianteil.
„Dieses Land fliegt bald in die Luft. Ich bin Voodoopriester, ich weiß es.“
„Woher?“
„Meine Mutter war eine mambo. Ich weiß es.“
„Was?“
„Alles ist manipuliert. Die haben ihren Plan, und den führen sie aus.“
„Wer, die? Was für einen Plan?“
Mein Freund antwortet mit dem starren kalten Blick überlegenen Wissens, dem universellen, dominanten Starren des Alphamännchens. Ich habe es bei den Black Panthers und den Jüngern von Timothy Leary gesehen, und natürlich kamen auch sie, wie uns inzwischen klargeworden ist, um die Welt zu beherrschen – oder zumindest bestimmte Viertel von Oakland und Newark. Während dieses Gesprächs standen wir auf der Straße vor dem schick amerikanisch gestylten Geschäft namens Le Shop-Shop.
Es wurde einem immer geraten, Fragen nicht so zu stellen, daß sie mit Ja oder Nein beantwortet werden können, wie etwa: „Geht es hier zum Shop-Shop?“ Weil die angesprochene Person immer mit Ja antworten würde, da es unhöflich war, einem Fremden gegenüber nein zu sagen. „Wo geht es zum …?“ war die brauchbarere Formulierung.
Heutzutage, wo die Verzweiflung Paranoia hervorbringt und geheimes Wissen – das heißt die Anmaßung von Wissen –, könnte die Frage: „Wo geht es zum …?“ mit: „Ich weiß es, du nicht“ beantwortet werden.
In den Zeitungen hat es immer feierliche Leitartikel gegeben, wie den folgenden, den ich gerade gelesen habe: „Wir leben in Zeiten großer Unsicherheit, Angst und tiefer Nachdenklichkeit …“ Zwar kann nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung lesen. Aber unterbrochen durch kurze Perioden von Frohsinn, wenn eine korrupte Regierung von einer anderen korrupten Regierung ersetzt wird, die sich noch nicht als korrupt herausgestellt hat, spiegeln diese Worte einen fast durchgehenden Zyklus von Leid und Unterdrückung wider.
Gott und die Götter verhießen Frieden und Überfluß. Der ehemalige Salesianerpriester Jean-Bertrand Aristide war eine Zeitlang ihr Vertreter auf Erden. Es war kein Zufall, daß ihn seine verängstigten Anhänger während der Militärdiktatur von Cédras bei seinem Codenamen „Der Messias“ heraufbeschworen.
Er kam. Er wurde von Präsident Clintons Entgegenkommen sowie von der Angst vor an die Strände Floridas gespülten Bootsflüchtlingen nach Haiti zurückgebracht. Er kam, sah und verwandelte sich in einen weiteren mißlungenen Gott.
Haitifans stellen fest, daß der Haitianer als Einzelperson bezaubernd ist. Jede Gruppe hat allerdings die Tendenz, zum Pöbel zu werden. Die amoklaufenden Soldaten der Armée Cannibale können jetzt wieder Engel werden, wie es Amiot Métayer oben im Himmel nach den Warnschüssen in seine Augen und in sein Herz wurde, obwohl sich Der Messias, von Südafrikas Mbeki beschützt (der auch seine Hand über Simbabwes Mugabe hielt, solange er konnte), nach der tatkräftigen Rückendeckung durch den verstorbenen Amiot Métayer sehnen mag, dem keiner eine Träne nachweint.
Der Voodoopriester Max Beauvoir hatte einiges Ansehen gewonnen, denn er hatte an der Cornell University studiert und einem amerikanischen Chronisten einen Zombie (höchstwahrscheinlich einen katatonen Schizophrenen) geliefert, der lange genug aus seiner Trance erwacht war, um den Schriftsteller auf seinen „Gutgläubigers Reisen“ zu bitten, ihn nach Chicago zu bringen, mit irgendeiner schönen Frau bekannt zu machen und zum Essen im Pump Room Restaurant einzuladen. Das ist nicht das übliche Zombieverhalten; Zombies sind auch nicht mehr, was sie mal waren.
Max Beauvoirs Frau rief einmal an und bat mich, ihren Sohn aus dem Gefängnis zu holen. (Häufig kommende amerikanische Haitibesucher werden für CIA-Agenten gehalten, die Sachen regeln.) Jetzt hat Monsieur Beauvoir gemerkt, daß starke Führer in Mode sind, also hat er sich selbst zum „Großen Voodoopriester von Haiti“ gekürt, zu so etwas wie einem Voodoopapst, obwohl kein Kolleg von Voodookardinälen ihn ernannt hat.
Einer seiner Rivalen ist über Beauvoirs Hybris empört. Er hat die Angewohnheit, Besuchern bei der Begrüßung mitzuteilen: „Willkommen in Haiti, ich bin der größte Voodoopriester, nicht dieser andere Kerl.“
Rationales Verhalten schwindet im gleichen Maße wie die Versorgung mit Nahrung. Ein Fremder drang in ein Haus in Bourdon ein und verkündete: „Ich bin hier, um dich umzubringen.“ „Wieso?“ Die Frage irritierte den Killer. „Frag mich nicht. Ich weiß es selbst nicht. Ich tue nur meine Arbeit.“
Ein alter Freund erzählt mir kichernd, daß er jemandem, den er nicht leiden kann, einen Streich gespielt hat. „Ich habe ihn geoutet! Im Internet! Als CIA-Agent!“
„Ist er einer?“
Er zuckte die Achseln. „Ich habe sein Leben ruiniert. Jetzt ist alles, was er tut, zur Tarnung. Zur Tarnung! Im Internet!“
„Ist er einer?“ wiederholte ich.
Nichts als ein Lächeln stiller Genugtuung auf dem Gesicht meines sonst so gesprächigen Freundes.
Manche der laufenden Ereignisse erscheinen einfach karnevalesk, aber es kommen Menschen dabei um. Die Polizei ist oft schlimmer als keine Polizei (Korruption); genauso Gerichte (vorherige Klammer wiederholen). Ohne Premierminister, wurde das Land im Juni 2008 nicht regiert. Präsident Préval, ein freundlicher Diplomlandwirt, früher ein Protegé von Aristide, ging wohlweislich auf Distanz zu dem unsauberen Exilierten. Aber nicht zu weit. Das Parlament erfreute sich an Ferien, auch wenn die ums Überleben Kämpfenden nie Ferien machen können. Die hiesigen Zeitungen haben eine Kurzversion für die allgemeine Lage, die sie wie einen Schlachtruf wiederholen: La pauvre Haïti. Armes Haiti.
Es fand jedoch eine überfüllte Buchmesse statt, auf der viele frühere und zukünftige Kandidaten für das Präsidentenamt bereitwillig ihre Bücher signierten. Es heißt, daß jeder Haitianer mit einem höheren Schulabschluß als der Mittleren Reife meint, er verdiene eine höhere Stellung als die eines Senators; wenn schon nicht Präsident, dann Schriftsteller.
Früher gab es im Nouvelliste eine Zusammenfassung des US-Börsenberichts, doch mangels Interesse wurde dieser Service eingestellt. Nachrichten von der Literatur- und Kunstfront hingegen haben zugenommen, genauso wie die Berichterstattung über die boomende Mordrate: „… die drei (3) Söhne von Viola Robert“. Der Reporter war sorgfältig darauf bedacht, sowohl das Wort „drei“ wie die Zahl „3“ zu nennen, wonach er vorschlug, die Polizei solle gut aufpassen. Was sie tun sollte, wenn es im Interesse von höheren Chargen als einer Mutter ist. Vielleicht nach dem bevorstehenden langen Wochenende …
An diesem Tag des Jahres 2008 kam ich infolge eines begeisterten, aber hastigen Abendessens zu dem Schluß, daß es keine Atheisten gibt, die in Drittweltländern über Kloschüsseln hängen.
(...)