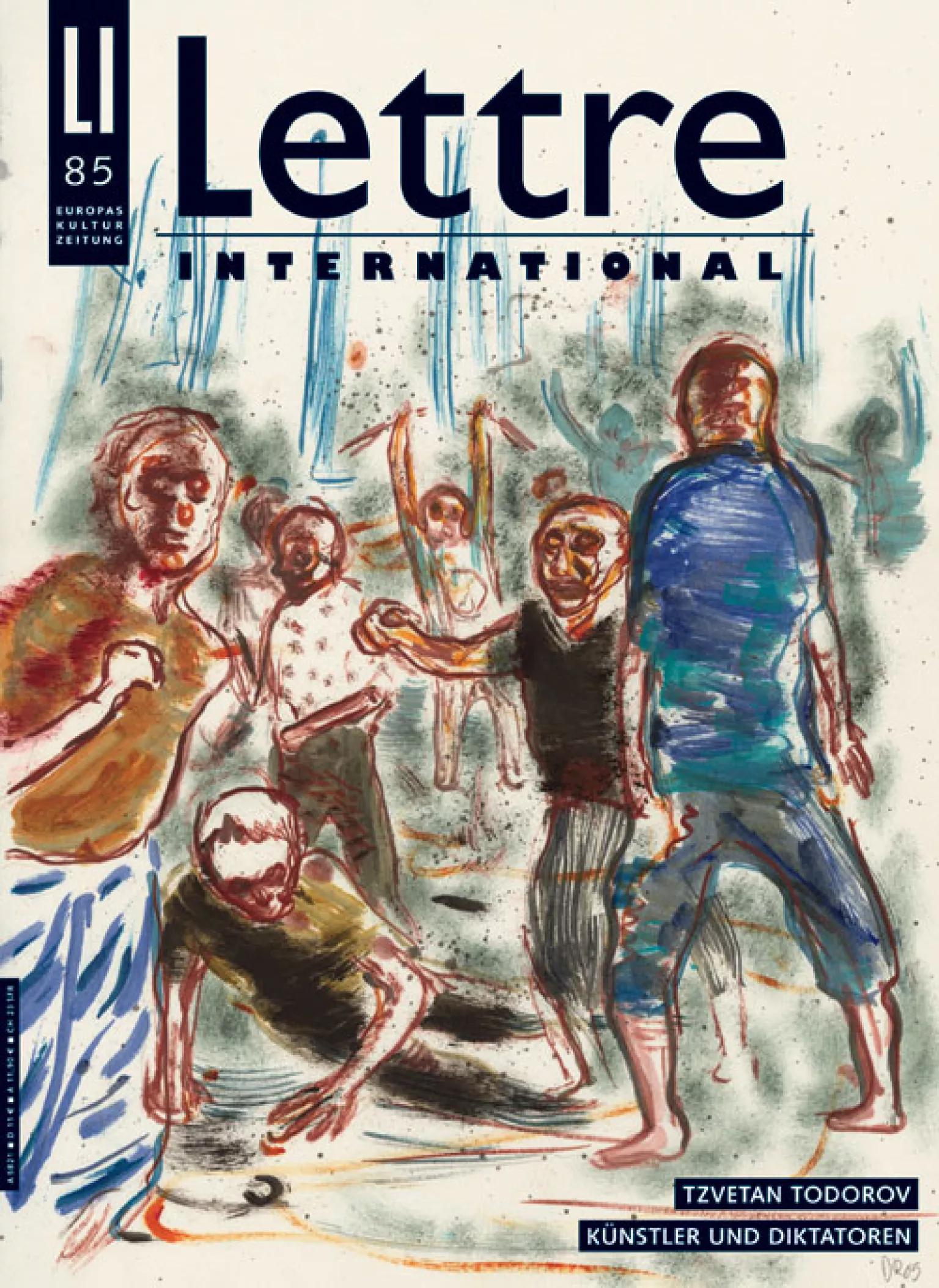LI 85, Sommer 2009
Ruandas Hoffnung
Das Leben mit der Erinnerung und die schwierige VersöhnungspolitikElementardaten
Genre: Investigation, Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Englischen von Daniel Bickermann
Textauszug
ALS ich 1995, ein Jahr nach dem Völkermord, begann, durch Ruanda zu reisen, war dieses Land praktisch ausgemerzt: blutverschmiert und geplündert; Gruppen von Waisen irrten durch die Hügellandschaften, vergewaltigte Frauen hausten in Ruinen; die Menschlichkeit des Landes war verraten, seine Infrastruktur zerschlagen, seine Wirtschaft demontiert, seine Regierung zusammengebastelt; ein Besatzungsstaat voller Soldaten, sein Justizsystem korrumpiert, seine Gefängnislager bis an den Rand gefüllt mit Mördern, und weitere Mörder liefen noch frei herum, jagten die Überlebenden und wurden selbst gejagt von Rachemördern; die zerschlagene Armee campierte mit den Milizen des Völkermords und anderthalb Millionen ihrer Anhänger an der Landesgrenze und erhielt Hilfe vom Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, während sie schworen, zurückzukehren und ihre Arbeit zu vollenden.
Innerhalb von hundert Tagen waren nach dem 6. April 1994 beinahe eine Million Menschen, die der Tutsi-Minderheit angehörten, im Namen einer Ideologie namens Hutu Power abgeschlachtet worden. Gefangen zwischen der Erinnerung an dieses Massaker und der Angst, daß es sich wiederholen könnte, fühlte sich Ruanda oft wie ein unrettbares Land an. Wenn die Ruander heute auf diese ersten Jahre nach der Katastrophe zurückblicken, sagen sie: „Am An-fang.“
Am 15. Jahrestag des Völkermords ist Ruanda eines der sichersten und geordnetsten Länder Afrikas. Seit 1994 hat sich das Bruttoinlandsprodukt beinahe verdreifacht, während die Bevölkerung um 25 Prozent auf mehr als 10 Millionen gewachsen ist. Es gibt eine staatliche Gesundheitsversorgung und ein ständig verbessertes Bildungssystem. Die Tourismusindustrie boomt und zieht viel ausländisches Kapital ins Land. In der Hauptstadt Kigali fegen Frauen in Kleid und Handschuhen mit ihren Rutenbesen bei Sonnenuntergang die Straßen. Plastiktüten wurden abgeschafft, um das Müllproblem unter Kontrolle zu halten und die Umwelt zu schützen. Breitband-Internetverbindungen sind in den Städten weit verbreitet, und die Kabel werden bereits in die ländlichen Gebiete verlegt. Mobiltelefone haben fast flächendeckend Empfang. Die Verkehrspolizei kontrolliert die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und die gesetzliche Gurt- und Motorradhelmpflicht. Regierungsbeamte müssen früh um sieben Uhr an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Seine Regierung ist die einzige der Welt, bei der die Frauen im Parlament in der Mehrheit sind. Man sieht fast nirgends mehr Soldaten. In Kigali leben inzwischen fast eine Million Menschen – ungefähr doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren – und es sind unablässig Bauarbeiten für neue Wohnungen, Bürohäuser, medizinische Einrichtungen, Einkaufszentren, Hotels, Verkehrseinrichtungen, ausländische Vertretungen und Straßen im Gange. Früher stand an einem der großen Verkehrsknotenpunkte eine Werbetafel, die von Maschinengewehrkugeln durchlöchert war und dunkles Bier von Guinness mit dem Slogan „Die Kraft der Liebe“ bewarb; heute verkündet ein neues Schild neben der Straße: „Zahl deine Steuern – Hilf beim Aufbau von Ruanda – Sei stolz“. Die meisten der Gefangenen, die wegen des Völkermords angeklagt oder verurteilt worden waren, sind inzwischen freigelassen. Die Todesstrafe wurde abgeschafft. Und Ruanda ist die einzige Nation, in der Hunderttausende Menschen, die am Massenmord beteiligt waren, sich in jeder Gesellschaftsschicht unter die Familien ihrer Opfer gemischt haben.
„So weit, so gut“, konstatiert Paul Kagame, Ruandas Präsident. Kagame ist 51 Jahre alt und so dünn, daß es auf offiziellen Photographien von Staatsbesuchen so aussieht, als würde der Gast mit einer Pappfigur posieren. Er führte einst die Rebellentruppen an – die Ruandische Patriotische Front (RPF) –, die den Völkermord beendeten. Seitdem entscheidet er über Ruandas Schicksal, und seine Feinde halten ihn ebenso wie seine Bewunderer für eine der beeindruckendsten politischen Persönlichkeiten unserer Zeit. „15 Jahre“, erzählt er. „Das klingt nach einer langen Zeit. Aber wenn man darüber nachdenkt und über den Wert unserer Nation – und vielleicht darüber, wie weit unser Land inzwischen gekommen ist und wie weit es hätte kommen sollen –, ist das gar nicht so viel.“
Kagame, der üblicherweise sogar von der ruandischen Presse als autoritär bezeichnet wird, wurde 2003 von mehr als 93 Prozent der Stimmen wiedergewählt, da er praktisch ohne Gegner antrat. Und doch sagt er, daß „alles umsonst“ gewesen sei, wenn es ihm nicht gelingen sollte, die staatlichen Institutionen so aufzubauen, daß er 2017, wie von der Verfassung vorgesehen, zurücktreten und einen friedlichen Machtwechsel vollziehen könne. In der Zwischenzeit regt er sich über westliche Beobachter auf, die nur das beurteilen wollen, was alles noch nicht erreicht wurde, anstatt die Fortschritte zu beachten. Seine Haltung dazu ist: Wer redet denn da? „Ich wünschte, es gäbe einen Weg, an der Uhr zu drehen und die Zeit schneller vergehen zu lassen“, sagt er. „Ich würde es machen.“ Seiner Ansicht nach hat der Westen keinerlei Recht, Ruanda zu belehren, nachdem das kolonialistische Erbe direkt in den Völkermord geführt hat und nachdem einige Westmächte (vor allem Frankreich und der Vatikan) die génocidaires vor, während und nach dem Massaker unterstützten und der Rest der Westmächte keinen Finger rührte, um das Morden zu unterbinden. Wie die meisten seiner früheren Kameraden aus der RPF wuchs Kagame im Exil in Uganda auf, als Flüchtling vor früheren Pogromen gegen die Tutsi. Verachtung liegt in seiner Stimme, wenn er von Kritikern seiner Menschenrechtsbilanz redet, die doch jahrzehntelang die ethnische Apartheid in seiner Kindheit und Jugend als legitime Form der Mehrheitsherrschaft akzeptiert hatten.
„1977 kam ich das erste Mal in mein Land“, erzählt er. „Ich war noch sehr jung und besuchte Verwandte, die inzwischen im Völkermord umgekommen sind.“ Als Jugendlicher kannte er Ruanda nur aus den Erinnerungen seiner Fa-milienmitglieder und aus den Gerüchten anderer Exilanten. Er war vier Jahre alt, als seine Familien floh, und 19, als er heimlich für diesen ersten Besuch zurückkehrte, um sich selbst einen Eindruck vom Land zu machen. „Sogar in diesem Alter sah ich die Unterdrückung“, sagte er. „Ich erkannte die Panik und die Frustration und Verzweiflung in den Menschen, die ich besuchte … Ich war nur ein Schüler, verstehen Sie, und machte gerade meinen Abschluß, und das waren meine Tante und mein Onkel. Aber sie wurden jeden Tag überwacht, um festzustellen, wer sie besuchte, wem sie Briefe schrieben und wer ihnen zurückschrieb. Einerseits waren sie natürlich glücklich, mich zu sehen, andererseits wollten sie, daß ich verschwinde und sie in Ruhe ließ. Denn hätte man herausgefunden, daß ich aus einem Flüchtlingslager in Uganda gekommen war, hätte man sie sehr einfach verschwinden lassen können.“
Zwischen 1995 und 2000 traf ich Kagame fünfmal; bei jeder Gelegenheit dauerte das Interview Stunden, und oft erzählte er dabei von seiner Jugend im Exil und wie diese Erfahrung des Ausschlusses ihn als jungen Mann zum bewaffneten Kampf geführt habe. Aber wenn er von sich selbst als Tutsi sprach, dann nur als Identität, die man gegen ihn verwendet habe, niemals als affirmative Erklärung einer Zugehörigkeit. Selbst als er in Ruanda an die Macht kam, wurde die Tatsache, daß er ein Tutsi war, noch gegen ihn verwendet. Es markierte ihn als Angehörigen einer Minderheit, und für jene, die weiterhin glaubten, daß alle ruandische Politik stammesbezogen sein müsse, beraubte ihn das seiner Legitimation. Kagame wollte nicht als Tutsi-Präsident angesehen werden, er wollte, daß man ihn als Präsident aller Ruander akzeptiert.
Emmanuel Ndahiro, einer von Kagames engsten Beratern und inzwischen Leiter des Geheimdienstes, erzählt mir, wie ermutigt er von der Wahl Barack Obamas sei. „Obama repräsentiert Ideen und eine Art zu denken. Er repräsentiert nicht nur die Schwarzen“, sagt Ndahiro und fragt: „Also warum kann nicht ein Tutsi in einem Land Präsident sein, in dem mehrheitlich Hutu leben?“ Der Völkermord erschwerte Kagames Kandidatur– und machte es noch wichtiger, daß er gewann. Als Kagame von dem Terror spricht, den seine Tante und sein Onkel als normal hinnehmen mußten, wüßte ich gerne, ob er sicher sei, daß die Hutu in den ländlichen Gebieten seines Landes sich nach dem Völkermord nicht selbst unterdrückt fühlten. „Mich sollten Sie das nicht fragen“, antwortet Kagame. „Gehen Sie und fragen Sie die Leute. Die sagen Ihnen ihre Meinung selbst.“ Er erklärt mir seine Sicht der Dinge trotzdem: „10 Millionen Menschen leben heute in diesem Land glücklicher als jemals zuvor in unserer Geschichte. Ruanda geht es besser, viel besser als je zuvor. Daran besteht für mich kein Zweifel. Schauen Sie sich um, reisen Sie durch das Land, besuchen Sie die Dörfer. Wenn Sie in den Augen der Menschen keine Hoffnung sehen, dann soll ich ein Lügner sein.“
(...)