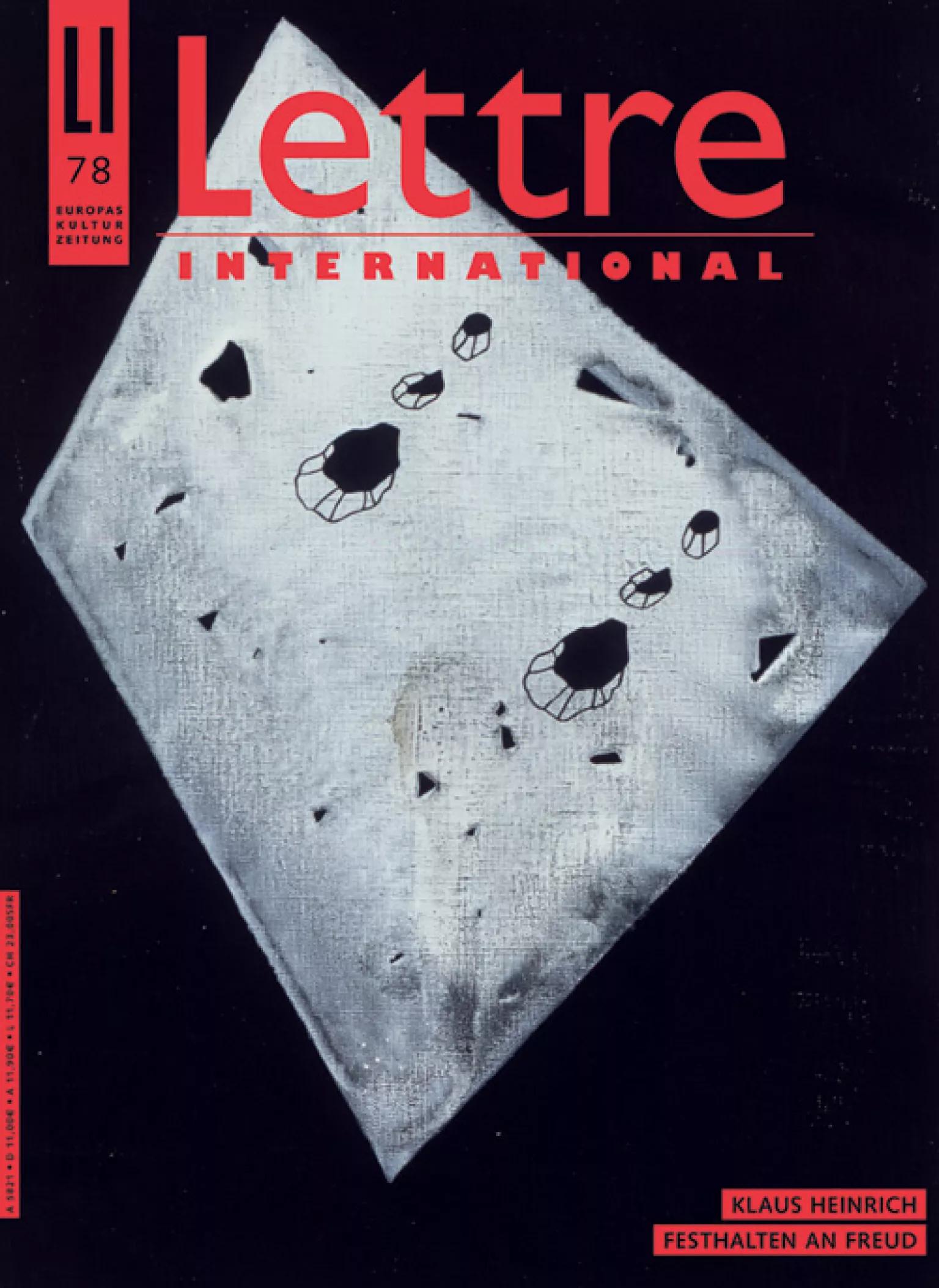LI 78, Herbst 2007
Festhalten an Freud
Eine Heine-Freud-Miniatur zur bleibenden Aktualität des Aufklärers FreundElementardaten
Textauszug
(...) "Festhalten an Freud“ – ein Titel wie dieser bedarf der Erläuterung, zumal in einem Jubiläumsjahr, in dem sich viele, kaum daß er hochgerufen ist, an dem verehrten Ahn festhalten werden. Aber halten sie auch an ihm fest? – Festhalten hat einen apologetischen Zug, und in der Tat: Hirnforschung, Traumforschung, Verhaltensforschung scheinen über Freud hinweggegangen, seine Spekulationen über die Frühzeit des Menschengeschlechts nurmehr ein Exempel spätaufklärerischer Mythenbildung zu sein, Soziologen konstatieren das Ende seiner seismischen Wirksamkeit, er wird heute vorzugsweise aus historischem oder literarischem Interesse gelesen, und selbst in seiner eigenen Disziplin, der Psychoanalyse, haben die Schulen ihn und sein therapeutisches Instrumentarium mit Ehrerbietung hinter sich gelassen. Natürlich bauen sie alle auf ihm auf, und gerade die Neuerer unter seinen Nachfolgern, Kleinianer, Lacanianer, große Einzelgänger wie Bion oder Winnicott, haben daraus nie ein Hehl gemacht. Aber eine um die Anerkennung ihrer therapeutischen Erfolge kämpfende, die kassenärztliche Zulassung immer wieder neu erstreitende Berufsorganisation hat die Trieblehre ihres Großvaters längst als Ballast über Bord geworfen – ein Relikt des vorvergangenen Jahrhunderts, das in zeitgenössische theoretische Konzepte zu übersetzen müßig erscheint. Und nicht minder müßig scheint es zu sein, das individuelle und das kollektive Seelenleben, nun gar die „archaische Erbschaft“ (Freuds Begriff!) und die aktuelle Seelenlandschaft – also die frühe und die eigene traumatisierte Realität – miteinander in eine reale Wechselbeziehung setzen zu wollen. Aber genau das, wir erinnern uns, hat Freud getan.
Als ich 1989 eine Rede Freud zu Ehren hielt, zu seinem 50. Todestag also, galt sie keinem Toten. Ich konnte sie demgemäß mit einem offenkundig doppeldeutigen Titel versehen: „Anfangen mit Freud“. Das war einerseits historiographisch, andererseits appellativ gemeint. Zu erzählen war die zuerst tröpfelnde, dann politisch explodierende und bald danach von einer dogmatischen Linken kassierte Wiederauferstehung Freuds an den Berliner Universitäten nach der damnatio memoriae des NS. Aufzufordern war zu einem die neuerliche szientifische und gesellschaftliche Isolierung durchstoßenden Neuanfang. Das war damals ein Thema für Psychoanalytiker. Heute, so vermute ich, wende ich mich an Geisteswissenschaftler verschiedener Disziplinen, Intellektuelle über Fachgrenzen hinweg. Natürlich werde ich den Abstand zu damals reflektieren müssen – Deutschlands Normalisierung ist ja durch eine große Verdrängungsleistung erkauft, nennen wir sie in Kürze: die uns vor der eigenen Geschichte abschottende Historisierung des NS. Meine apologetische Formulierung will dem Rechnung tragen, aber sie hat auch dieses Mal Appellcharakter. Festhalten an Freud, das heißt für mich: festhalten an ihm als einem Bundesgenossen unseres Denkens, auf den wir heute weniger denn je verzichten können. Ich zum Beispiel hätte ohne ihn nicht Philosophie und Religionswissenschaft betreiben, geschweige einer halbtoten, um ihr Überleben kämpfenden Institution wie der Universität die Treue halten können. Daß dies nicht meine Privatangelegenheit war, sondern allenfalls die private Formulierung eines öffentlich verdrängten Interesses, hoffe ich mit meinem Vortrag zeigen zu können.
Festhalten an Freud, das heißt heute erst einmal: nicht zurückfallen hinter ihn. Und weil der Blick auf ihn zugleich auf seinen „Unglaubensgenossen“ Heine fallen soll – das, wie Sie wissen, der wunderschöne, von Heine selbst geprägte, dann von Freud auf ihn gemünzte, durchaus identifikatorisch aufgeladene, weil beider desillusionierendem Wahrheitspathos sich verdankende Bündnisbegriff –, werde ich mit einer Heine-Freud-Miniatur beginnen. Sie wird auch meine weitere Annäherung an Freud grundieren.
Der fünfundsiebzigjährige Freud, von seiner Kieferprothese geplagt, unfähig, als ein Redner vor ein größeres Publikum zu treten, phantasiert sich noch einmal in den Hörsaal zurück und setzt die Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse von 1916/17 mit einer Neue(n) Folge, fertiggestellt 1932, erschienen 1933, fort. Durch Weiterzählung der Vorlesungsstunden von XXIX bis XXXV sucht er das Forschungskontinuum der Psychoanalyse trotz Spaltungen und Schulstreit zu beschwören. Die Neue Folge bietet kritische Revisionen, ergänzende und weiterführende Gedanken, vor allem aber: Sie ist eine Bekenntnisschrift. Angesichts konkurrierender „Weltanschauungen“ verwahrt er sich dagegen, daß die Psychoanalyse eine neue, eigene hervorbringen werde. Ich zitiere: „Sie braucht es nicht, sie ist ein Stück Wissen-schaft und kann sich der wissenschaftlichen Weltanschauung anschließen.“
Und dann, hellsichtig im Blick auf eine Zukunft, die mit dem Begriff „Weltanschauung“ Schindluder treiben wird: „Diese“ (die Wissenschaft) „verdient kaum den großtönenden Namen“ (also Weltanschauung), „denn sie schaut nicht alles an, sie ist zu unvollendet, erhebt keinen Anspruch auf Geschlossenheit und Systembildung. Das wissenschaftliche Denken ist noch sehr jung unter den Menschen, hat zuviele der großen Probleme noch nicht bewältigen können. Eine auf die Wissenschaft aufgebaute Weltanschauung hat außer der Betonung der realen Außenwelt wesentlich negative Züge, wie die Beschei-dung zur Wahrheit, die Ablehnung der Illusionen.“ Sie sehen, der Skeptiker Freud hält zwar fest an einem Fortschrittsbegriff – „noch nicht“ sagt er, so wie der Haeckel der Welträtsel in dem berühmten Ignoramus-Ignorabimus-Streit des mit dem Erscheinen der Traumdeutung zu Ende gehenden Jahrhunderts –, aber er hätte mit gleichem Recht dem Ignorabimus des Du Bois-Reymond zustimmen können und hat es mit vielen seiner Äußerungen implizit getan: seinem Pochen auf die Nicht-Abschließbarkeit der Empirie in der Erforschung des Seelenlebens, die das Kennzeichen psychoanalytischen Denkens bis heute ist, verbunden mit „Wahrheit“ als einem desillusionierenden Korrektiv des Fortschrittsglaubens. Und schließlich die entschiedene, bereits eine zunehmende intellektuelle Isolierung verratende Absage an den Aktionismus seiner Zeit, auch in der eigenen Disziplin: „Wer von unseren Mitmenschen mit diesem Zustand der Dinge unzufrieden ist, wer zu seiner augenblicklichen Beschwichtigung mehr verlangt, der mag es sich beschaf-fen, wo er es findet. Wir werden es ihm nicht verübeln, können ihm nicht helfen, aber auch seinetwegen nicht anders denken.“
Ich habe hier das bekenntnishafte Ende der letzten, der XXXV. Vorlesung zitiert. Ein, wie ich finde, nicht weniger bemerkenswertes, weil die alten Antriebe seines Denkens einbeziehendes Bekenntnis verbirgt sich hinter dem auffälligen, als Vers angeschriebenen Heine-Zitat der XXXIII. Vorlesung mit der programmatischen Überschrift: „Die Weiblichkeit“. Er sagt zu dieser Vorlesung zunächst: „Sie bringt nichts als beobachtete Tatsachen, fast ohne Beisatz von Spekulation, und sie beschäftigt sich mit einem Thema, das Anspruch auf Ihr Interesse hat wie kaum ein anderes. Über das Rätsel der Weiblichkeit haben die Menschen zu allen Zeiten gegrübelt“ – es folgt ein Doppelpunkt und dann, in die Mitte der Seite gerückt, der unerwartet bunte Vers von vier Zeilen:
Häupter in Hieroglyphenmützen,
Häupter in Turban und schwarzem Barett,
Perückenhäupter und tausend andre,
Arme, schwitzende Menschenhäupter –
und in Klammern darunter, wie eine Unterschrift plaziert: „(Heine, Nordsee)“. – Freud fährt fort: „Auch Sie werden sich von diesem Grübeln nicht ausgeschlossen haben, insofern Sie Männer sind; von den Frauen unter Ihnen erwartet man es nicht, sie sind selbst dieses Rätsel.“
Nun bringt Freud in der Regel keine illustrierenden, sondern beglaubigende Zitate, oft auch solche, die einen längeren Kontext oder Subtext in verkürzter Form wiederauferstehen lassen. Sie liefern gleichsam die von der eigenen Deutung ausgelöste, dem Zitat anheimgestellte freie Assoziation. Unter diesem Gesichtspunkt hat auch unser Zitat eine erste, offen einsehbare Funktion: Es beschreibt, unter geradezu religionsfolkloristischen Vorzeichen, eine grüblerische Ansammlung des Menschengeschlechts – „Männergeschlechts“, muß man realistisch sagen, denn „Weiblichkeit“ scheint hier in der Tat nicht aufzutreten, sie ist ja selbst „das Rätsel“. Heine, der Schiller sehr schätzte, hätte an Freuds Stelle lieber gleich Das verschleierte Bild von Sais zitiert. Freud, auf den ersten Blick, greift zu Heine, weil in diesem Vers ein Konzentrat der Menschengattung, ihrer ungleichzeitigen und ungleichortigen Stationen sichtbar wird: die Alten Ägypter (Hieroglyphenmützen), die Muslime (der Turban), die mittelalterlich-katholische Geistlichkeit (das schwarze Barett), die Vertreter des -Ancien Régime (Perückenhäupter) … und die „tausend andere(n)“ offenbar nicht nur unter ihrer Grübelei, sondern ebenso unter der gesellschaftlichen Uniformierung ihrer Kopfbedeckungen schwitzenden und eben darum „armen“ Menschenhäupter. Immerhin, als Grübelgesellschaft scheint der männliche Anteil des Menschengeschlechts, in dieser Frage wenigstens, geeint.
(...)