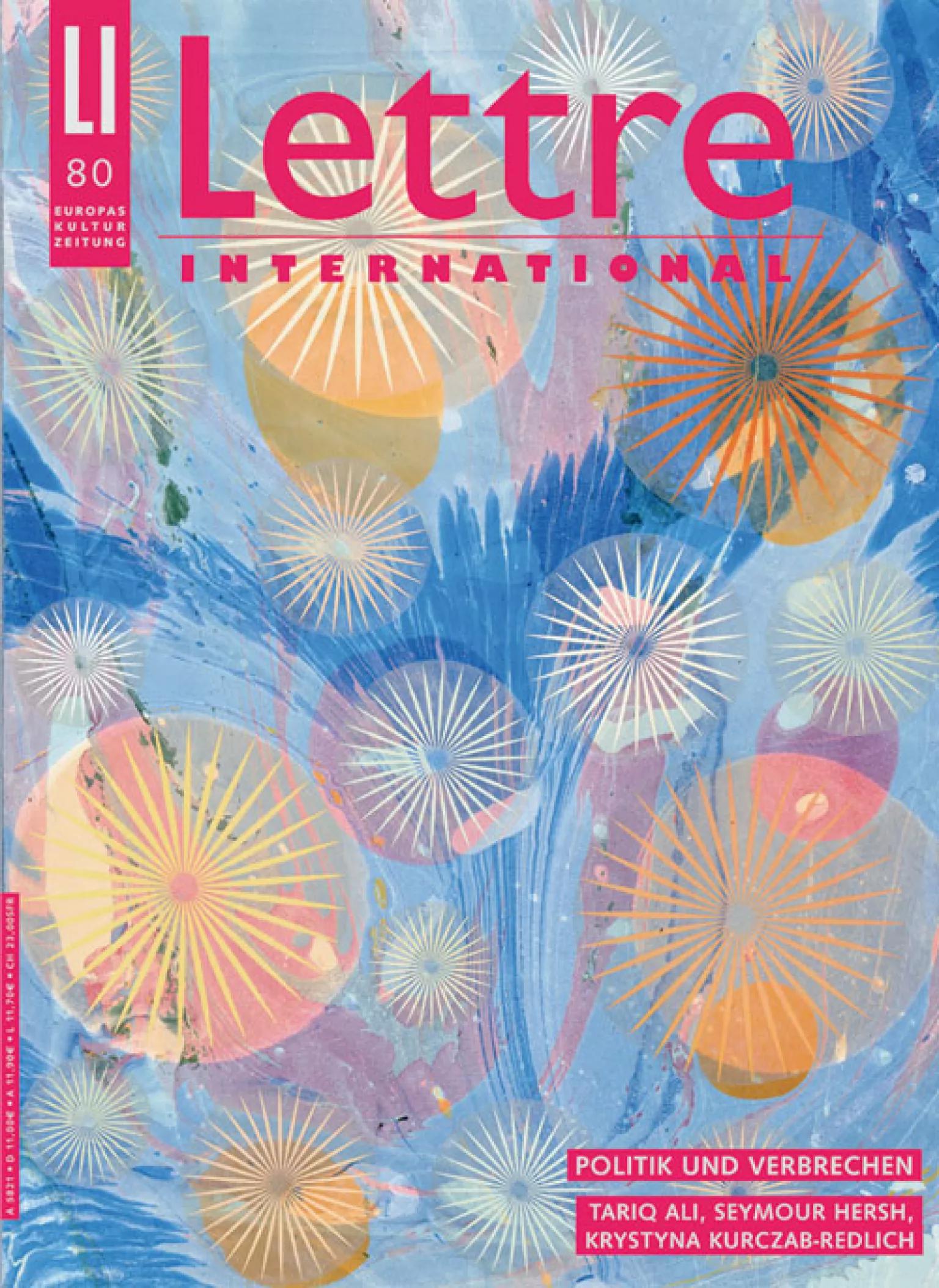LI 80, Frühjahr 2008
Sartre in Stammheim
Der Philosoph beim Staatsfeind Nummer eins - Ein Besuch und seine FolgenElementardaten
Textauszug
Eine denkwürdige Aufnahme. Zu sehen sind drei Insassen eines Pkws: Auf dem Beifahrersitz mit Jean-Paul Sartre der berühmteste Philosoph seiner Zeit; auf dem Rücksitz dahinter ein Rechtsanwalt, der RAF-Verteidiger Klaus Croissant, über dessen Kanzlei behauptet wurde, sie sei die größte Personalrekrutierungsstelle gewesen, über die die terroristische Gruppe jemals verfügt habe; und am Steuer mit Hans-Joachim Klein ein damals völlig unbekannter junger Mann, dessen Bild ein Jahr später um die Welt ging, als er an der Seite des international gesuchten Terroristen Carlos am blutigen Überfall auf das OPEC-Treffen in Wien beteiligt war. Von der Kamera nicht eingefangen wurde jene Person, die für das Zustandekommen dieses denkwürdigen Trios vielleicht unverzichtbar gewesen ist: Daniel Cohn-Bendit, Ikone des Pariser Mai und heute Europa-Abgeordneter der Grünen in Straßburg. Die Aufnahme ist vor 34 Jahren in Stuttgart gemacht worden, am 4. Dezember 1974.
Nichts hat, so ließ sich kurz darauf feststellen, Sartres Ruf in Deutschland so sehr beschädigt wie seine Bereitschaft, Andreas Baader, dem führenden Mann der RAF, einen Besuch in Stuttgart-Stammheim abzustatten. Sartres als Solidaritätsakt geplanter Schritt wurde zum öffentlichen Fiasko, aber auch zu einer persönlichen Blamage. Daß er damit weder den im Hungerstreik befindlichen RAF-Gefangenen noch sich selbst einen Gefallen getan hatte, verriet sich bereits auf der anschließenden Pressekonferenz in einem Stuttgarter Hotel. Als Sartre seine Eindrücke von „Baaders Zelle“ beschreiben wollte, stellte sich heraus, daß er diese gar nicht gesehen haben konnte, sondern lediglich den Besucherraum. Seine Beurteilung der Haftbedingungen erwies sich als völlig wertlos. Das war keineswegs alles. Heute ist es möglich, die Geschichte dieses spektakulären Besuches genauer nachzuzeichnen und neu zu bewerten. Inzwischen liegen Quellen vor, die einen Blick hinter die Gardinen erlauben.
Wie hatte es die RAF überhaupt fertiggebracht, einen der bedeutendsten Philosophen des 20.?Jahrhunderts zu ihrem verlängerten Arm zu machen? War es von Sartres Seite aus schlichtweg Naivität? Oder war für ihn die RAF eine Projektionsfläche, weil er in Baader, Meinhof, Ensslin und den anderen eine Art Widerstandsgruppe zu erkennen glaubte? Oder hatte er nicht selbst – man denke an sein Vorwort zu Fanons Die Verdammten dieser Erde? – eine Einstellung, die ihn für die von der RAF propagierte Gewaltrhetorik besonders empfänglich machte? Wer hatte ihn überhaupt für diesen öffentlichkeitswirksamen Akt gewonnen?
Die Geschichte der RAF ist durch kaum etwas so geprägt worden wie durch ihre Hungerstreiks.
Nachdem die Gründer der RAF im Juni 1972 verhaftet worden waren, setzten sie den Hungerstreik als Mittel zur Fortsetzung ihres aussichtslos gewordenen politischen Kampfes ein. Es waren insgesamt zehn; der erste fand 1973 statt, der letzte im Frühjahr 1989. Die RAF-Gefangenen forderten neben einer Verbesserung ihrer Haftbedingungen ihre Zusammenlegung und beanspruchten eine Anerkennung als Kriegsgefangene. Der längste und härteste Hungerstreik war der dritte. Er begann am 13. September 1974 und dauerte 145 Tage. Im Kontext dieses Konfliktes stand Sartres Besuch in Stammheim.
Trotz künstlicher Ernährung starb nach 58 Tagen einer der Gefangenen. Es war der 9. November 1974. Der Tote hieß Holger Meins. Er war 33 Jahre alt geworden. Am Ende wog er bei einer Größe von 1,86 Meter nicht mehr als 39 Kilogramm. Ein Photo seines ausgemergelten Leichnams wurde anschließend auf Demonstrationen wie eine Monstranz umhergetragen, um die als unmenschlich angesehene Praxis von Staat und Justiz anzuprangern. Am 18. November 1974 wurde Meins in Hamburg zu Grabe getragen. An der Beerdigung nahm auch der damalige RAF-Anwalt und spätere Bundesinnenminister Otto Schily teil. Er sprach von einer „Hinrichtung auf Raten“. In mehreren Städten kam es zu Demonstrationen mit Tausenden von Teilnehmern. Sie warfen den Justizbehörden eine Mitschuld am Tod des Hungerstreikenden vor. Wie aufgewühlt und auch rachedurstig die Atmosphäre damals war, läßt sich daran erkennen, daß Hans-Joachim Klein – wie er in einem Dokumentarfilm einräumte – entschlossen war, in Reaktion auf den Tod des Hungerstreikenden zwei Polizisten zu erschießen. Es sei lediglich dem mäßigenden Einfluß seines Freundes und späteren Kabarettisten Matthias Beltz zuzuschreiben gewesen, daß er sich auf einer anschließenden Demonstration von einer solchen Mordtat habe abhalten lassen.
Doch was in Frankfurt in letzter Minute verhindert werden konnte, wurde zur selben Zeit in West-Berlin gespenstische Wirklichkeit. Unbekannte Mitglieder der Bewegung 2. Juni erschossen dort den Kammergerichtspräsidenten Günter von Drenkmann, einen als liberal geltenden Juristen, der nicht einmal etwas mit RAF-Verfahren zu tun hatte. Die Attentäter, die den Richter ursprünglich hatten entführen wollen, waren auf besonders infame Weise vorgegangen. Sie klingelten am Abend mit einem Fleurop-Blumenstrauß und baten um Einlaß. Als der Vierundsechzigjährige erkannte, was die Eindringlinge im Schilde führten, und sich zu wehren begann, zogen sie ihre Waffen und streckten ihn im Beisein seiner Ehefrau nieder.
Die RAF ließ keinen Zweifel daran aufkommen, wie sie zu der Mordtat stand. Unter dem Titel Solidarität und Lernprozeß verfaßte ihre in Stammheim inhaftierte Führungscrew eine im Brustton der Überzeugung gehaltene Rechtfertigungsschrift. Die „Hinrichtung des Richters“, hieß es im Untertitel, sei „ein Teil der Solidarität mit dem Hungerstreik der RAF“. Unerbittlich hieß es weiter: „Wir weinen dem toten Drenkmann keine Träne nach. Wir freuen uns über eine solche Hinrichtung. Diese Aktion war notwendig, weil sie jedem Justiz- und Bullenschwein klargemacht hat, daß auch er – und zwar heute schon – zur Verantwortung gezogen werden kann. Sie war nützlich, weil der Tod von Holger MEINS nicht nur bejammert worden ist … Sie war beispielhaft, weil sie dem dauernden Gerede über die Übermacht des Staatsapparates, das nur Resignation auslösen kann, ein Ende bereitet hat …“? Notwendig, nützlich, beispielhaft – die Diktion erinnerte an Ulrike Meinhofs bizarre Rechtfertigungsschrift für den Überfall auf die israelische Olympiamannschaft, in der sie die Geiselnahme durch die Gruppe Schwarzer September als eine modellhafte antiimperialistische Aktion gefeiert hatte.
Man braucht nicht viel Phantasie, um zu begreifen, warum Sartre für einen Akt der Solidarität gegenüber der RAF disponiert gewesen sein dürfte. Grundlegend waren seine Affinität zu einer revolutionär verstandenen Praxis der Gewalt und zu Gruppen der radikalen, nichtkommunistischen Linken. Nach den Geschehnissen des Mai 1968 hatte er sich demonstrativ auf die Seite der Gauche prolétarienne gestellt, eine militant maoistische Organisation, zu der Alain Geismar, André Glucksmann, Serge July und Benny Lévy gehörten. Ihr bundesdeutsches Pendant war die Frankfurter Betriebsgruppe Revolutionärer Kampf (RK), zu der neben Cohn-Bendit und Joschka Fischer zeitweilig auch Hans-Joachim Klein gehörte. Die aus der antiautoritären Fraktion des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) entstandene Organisation lehnte die terroristische Praxis ab, vertrat jedoch die Überzeugung, daß die RAF als ein Teil der Linken verstanden werden müsse und deshalb eine solidarische Kritik verdiene. Diese etwa von Cohn-Bendit öffentlich vertretene Haltung beschreibt auch ziemlich genau Sartres Einstellung gegenüber der Gruppe um Baader und Meinhof.
Bei dem nicht nur von RAF-Verteidigern lautstark erhobenen Vorwurf der „Isolationsfolter“ dürfte es in Sartres Ohren geklingelt haben. Sollte im Nachfolgestaat Nazi-Deutschlands erneut gefoltert werden? Und handelte es sich bei der Gruppe um Baader und Meinhof nicht um eine Art nachholender Résistance? Waren sie nicht – wie von vielen linken Intellektuellen behauptet – angetreten, einen „neuen Faschismus“ zu bekämpfen?
Spätestens im Februar 1973 war durch ein Interview bekannt geworden, daß Sartre die sich im Nachbarland um die RAF abspielenden Geschehnisse aufmerksam verfolgte. Er hatte erklärt: „Eine starke revolutionäre Strömung ist offenbar in Westdeutschland nicht vorhanden. Aber es gibt Kräfte, die mir interessant erscheinen, beispielsweise die Baader-Meinhof-Gruppe. … Sie trat wahrscheinlich verfrüht auf … Aber es scheint mir, daß die Energie, der Geist der Initiative und der Sinn für die Revolution bei ihr reell waren.“? Damit hatte er sich weiter hervorgewagt, als es irgendein bundesdeutscher Linksintellektueller hätte tun können, ohne dafür öffentlich in der Luft zerrissen zu werden. Was er an der RAF allein zu kritisieren schien, war das, was der SED-Kritiker und einstige Starintellektuelle der DDR, Wolfgang Harich, zuvor als „revolutionäre Ungeduld“ bezeichnet hatte. Die RAF, meinte Sartre, sei einfach zu früh losgeprescht. Es kann nicht überraschen, daß ein RAF-Anwalt wie Klaus Croissant, der ständig auf der Suche nach Unterstützern und Bündnispartnern für seine Mandanten war, bei der Lektüre neugierig wurde.
Der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll hatte bei den Bestrebungen, sich öffentlich für eine Verbesserung der Haftbedingungen einzusetzen, die bis dahin vielleicht wichtigste Funktion eingenommen. Doch Böll, der einst sogar „freies Geleit für Ulrike Meinhof“ gefordert hatte, war mit seinen Vermittlungsversuchen immer mehr unter Beschuß geraten. Und der Aufmerksamkeitswert würde bei dem Mann, der im Unterschied zum bedeutendsten deutschen Nachkriegsautor 1964 die Entgegennahme des Nobelpreises für Literatur abgelehnt hatte, zweifelsohne noch höher ausfallen.
Am „Staatsfeind Nummer eins“, wie Andreas Baader in der Hochzeit der RAF genannt wurde, schieden sich frühzeitig die Geister. Den Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, bei dem er im Mai 1970 vergeblich Unterschlupf suchte, erinnerte er an einen „Zuhälter“, Lorenz Jäger, einen Feuilleton-Redakteur der FAZ, der ihn als Gymnasiast erlebt hatte, beeindruckte er mit seiner „Raubkatzeneleganz“. Für die einen war er ein „Kleinkrimineller“, in Anspielung auf seine Vernarrtheit in Sportwagen gar ein „Großhubraumfetischist mit übersteigertem Selbstdarstellungs- und Imponiergehabe“ (Günter Wallraff), für die anderen war er ein „Revolutionär“ und „die absolute Nummer eins“ innerhalb der RAF. Horst Herold, der damalige Chef des Bundeskriminalamtes, der ihn von Heerscharen an Polizisten jagen und hinter Schloß und Riegel bringen ließ, hatte Respekt vor ihm und nannte ihn „einen Vulkan“. Er attestierte ihm eine „enorme kriminelle Kraftanstrengung“, mit der er nach innen seine Zellengenossen ideologisch zusammengehalten und nach außen die weiter im Untergrund operierenden RAF-Mitglieder dirigiert habe. Innerhalb der RAF war Baader die unbestrittene Führungsfigur, ein Mann, der von seinen Mitgefangenen ironisch wie respektvoll als „Generaldirektor“ bezeichnet wurde.
Warum es unbedingt Baader sein mußte, der Sartre empfangen sollte, scheint intern keinen Moment lang offen gewesen zu sein. Sartre gab später auf die Frage, warum er Baader und nicht Meinhof einen Besuch abgestattet habe, die Antwort, es heiße ja „Baader-Meinhof- und nicht Meinhof-Baader-Gruppe“. Das klang eher nach Verlegenheit. In dieser Hinsicht dürfte der prominente Autor ohnehin keine Wahl gehabt haben. Im Vorfeld war in den „info“-Zirkularen der RAF zweierlei verbreitet worden: Das Bundeskriminalamt beabsichtige, die Umstände des Hungerstreiks zu nutzen, um Baader zu ermorden, und nur durch den Besuch eines so prominenten Mannes wie Sartre könne dieser Mordversuch vielleicht noch verhindert werden. Sartre als indirekter Retter Baaders – so lautete die phantastisch anmutende Zuspitzung innerhalb der Gruppe. Im Auftrag der RAF-Spitze sollte Croissant an Sartre herantreten und ihn auffordern, Baader und keinem anderen einen Besuch abzustatten.
(...)