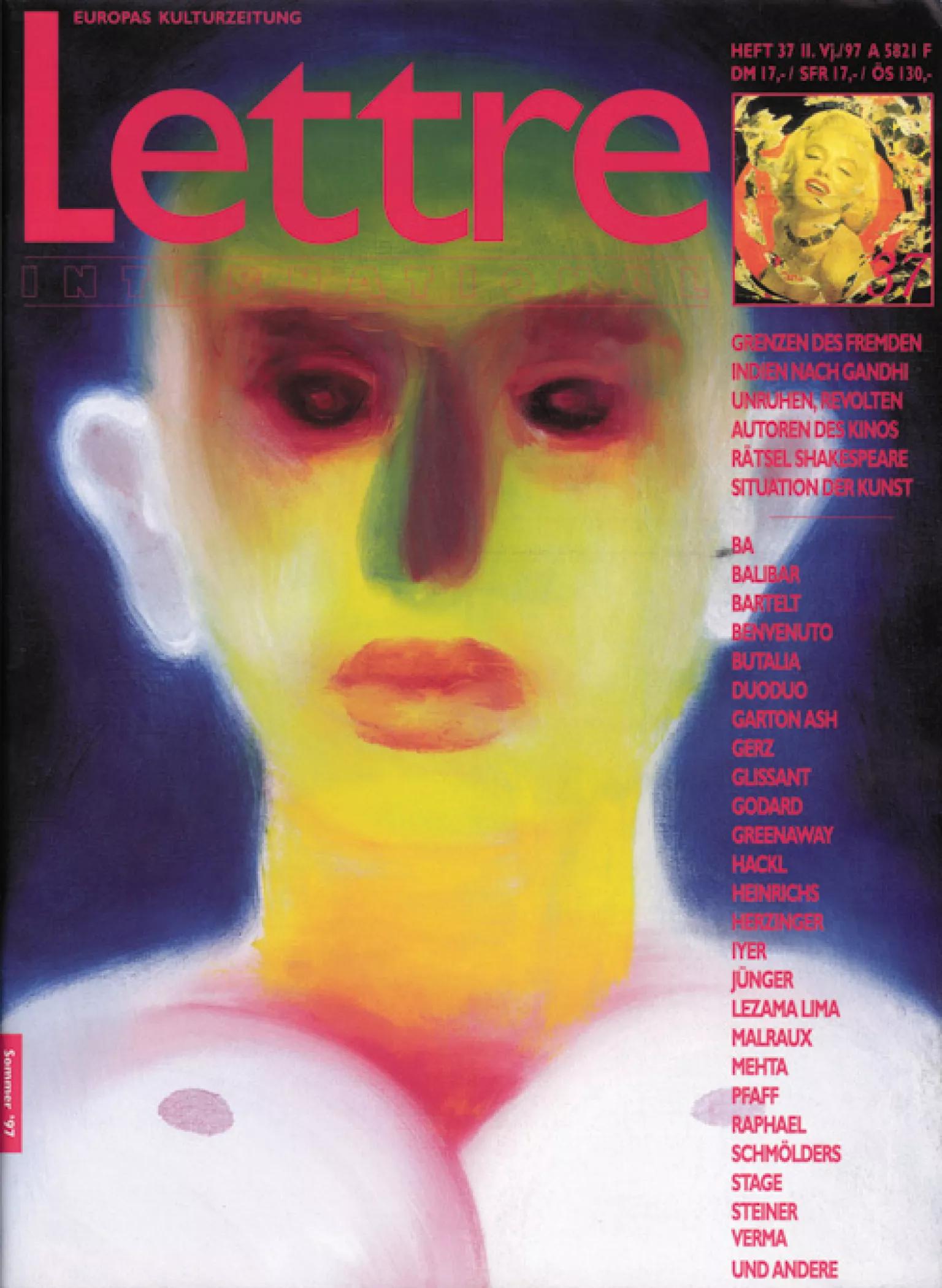LI 37, Sommer 1997
Mumbai
Eine Metropole im Krieg gegen sich selbstElementardaten
Genre: Stadtporträt
Übersetzung: Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
Textauszug
Bombay (heute offiziell Mumbai) ist eine Stadt in der Identitätskrise: eine Stadt, in der zugleich Hochkonjunktur und ziviler Notstand herrscht. Zwölf Millionen Menschen wurden hier bei der letzten Volkszählung registriert - mehr als in Griechenland -, die 38 Prozent der nationalen Steuern aufbrachten. Dennoch ist die Hälfte von Bombays Bewohnern obdachlos. In der Bayview Bar des Oberoi Hotel kann man eine Flasche Dom Perignon für 20.250 Rupien - mehr als das eineinhalbfache durchschnittliche Jahreseinkommen - bestellen; und das in einer Stadt, in der 40 Prozent aller Häuser über kein sauberes Trinkwasser verfügen. Mitten in einem Land, in dem noch immer etliche Menschen verhungern, bietet Bombay stolze 150 Diätkliniken. Urbs prima in Indis steht auf einem Schild vor dem Gateway of India. Bis zum Jahr 2020, so die Prognosen, wird Bombay die größte Stadt der Welt sein.
Vor über vier Jahren begann diese entzweite Metropole einen Krieg gegen sich selbst. Am 6. Dezember 1992 wurde Babri Masjid, eine Moschee in Ayodhya, von einer fanatischen Meute der Hindus zerstört. Ayodhya liegt im mehrere hundert Meilen weit entfernten Uttar Pradesh, aber der Schutt seiner Moschee legte sehr schnell das Fundament einer Mauer, die in Bombay zwischen Moslems und Hindus aufschoß. Während einer Serie von Krawallen starben 11.400 Menschen. Vier Jahre später, also Ende 1996, plante ich mit einer Gruppe von Frauen aus den Slums eine Reise. Als ich den darauffolgenden Freitag, den 6. Dezember, als Termin vorschlug, wurde es still. Die Frauen lachten etwas beklommen und sahen einander an. Schließlich sagte eine: "An diesem Tag wird niemand das Haus verlassen."
Die Krawalle waren eine Tragödie in drei Akten. Zunächst gab es spontane Auseinandersetzungen zwischen Moslems und der Polizei. Darauf folgte im Januar eine zweite, gewalttätigere Welle von Ausschreitungen, die von der hinduistischen politischen Bewegung Shiv Sena ausgingen. Dabei wurden Moslems systematisch ausgesondert und massakriert, ihre Häuser und Läden wurden geplündert und niedergebrannt. Die dritte Phase war die Rache der Moslems: Am 12. März detonierten, über die gesamte Stadt verteilt, zehn sprengkräftige Bomben. Eine davon explodierte in der Börse, eine andere im Hauptsitz der Air India. Bomben verbargen sich in Autos und Motorrollern. Dreihundertundsiebzehn Menschen starben, und viele davon waren Moslems.
Dennoch feierten viele Moslems die Täter. Es war die alte Geschichte: der machtvolle Wunsch der Minderheiten in aller Welt, Unterdrücker statt Unterdrückte zu sein. Fast jeder Moslem, mit dem ich in Bombay sprach, bestätigte, daß die Krawalle das Selbstwertgefühl der Minderheit zerstört hatten. Sie waren gezwungen, hilflos dazustehen und zuzusehen, wie ihre Söhne niedergemetzelt und ihre Habe verbrannt wurde. 1,6 Millionen Moslems gibt es in Bombay: über zehn Prozent der gesamten Stadtbevölkerung. In den Pendlerzügen standen sie mit gesenkten Köpfen. Wie konnten sie den siegreichen Hindus in die Augen sehen? Dann gingen die Bomben hoch, und die Hindus wurden daran erinnert, daß Moslems nicht wehrlos waren. Sie konnten die Züge wieder mit hoch erhobenen Köpfen betreten.
Im Dezember 1995 führte mich eine Gruppe von Shiv Sena-Männern durch das Schlachtfeld. Mit dabei war Raghav, ein Taxiunternehmer, ein kleiner, untersetzter Mann in Jeans der Marke Saviour (Erlöser). Er war kein offizielles Mitglied der Shiv Sena, aber der Leiter seiner Ortsgruppe wandte sich an ihn, wann immer es Parteiarbeit zu tun gab. Raghav führte mich durch Jogeshwari: den Slum, in dem am 8. Januar 1993 die zweite Welle der Gewalt begann. Eine Familie von Hindus, es waren Fabrikarbeiter, hatte in einem Zimmer im moslemischen Stadtteil Radhabai Chawl geschlafen. Jemand versperrte ihre Tür von außen und warf eine Benzinbombe durch das Fenster. Die Familie starb kreischend, bis zuletzt an der Tür scharrend. Auch ein Teenager, ein behindertes Mädchen, war darunter.
Raghav und einige andere führten mich auf dem Weg zu den Slums durch Gänge, die so schmal sind, daß zwei Menschen nicht aufrecht nebeneinander gehen können. Zuerst waren sie noch vorsichtig. Doch als wir an einer Moschee vorbeikamen, lachte Raghav. "Hier haben wir in die Masjid (Moschee) geschissen", sagte er. Einer seiner Begleiter warf ihm einen warnenden Blick zu. Erst später verstand ich, was er meinte. Die Zeloten der Sena hatten diese Moschee niedergebrannt; für sie war es ein Höhepunkt dieses Krieges, und sie erinnerten mit triumphierender Freude daran. Jemand hatte einer Gasflasche das Ventil geöffnet, ein Streichholz entzündet und die Flasche in das Bethaus gerollt. Später wurde er Polizist, und das ist er noch heute.
All das besprachen wir nicht flüsternd in irgendeinem Hinterzimmer, sondern mitten auf der Straße, am Vormittag und unter hunderten kommender und gehender Leute. Raghav war völlig unbefangen, er prahlte weder, noch versuchte er, seine Tat herunterzuspielen. Er erzählte einfach, wie es gewesen war. Die Männer der Sena - die sainiks - fühlten sich wohl; das hier war ihr Boden. Sie zeigten auf den einzig verbliebenen Laden in moslemischer Hand: ein Stoffgeschäft, das einmal Ghafoor's geheißen hatte. Während der Krawalle wollten einige Jugendliche den Besitzer töten, aber andere, die mit ihm aufgewachsen waren, nahmen ihn in Schutz. Also wurde nur sein Lager niedergebrannt, und er selbst kam ohne weiteren Schaden davon. Der Laden ist jetzt wieder geöffnet und nennt sich Maharashtra Mattress (Matratze). Raghav zeigte auf den Laden nebenan: "Das Batteriegeschäft habe ich geplündert", sagte er.
Er führte mich auf ein Brachgelände neben den Remisen. An einer Seite war ein riesiger Müllhaufen, Gruppen von Leuten gruben mit Spitzhacken im Boden, eine Horde von Jungen spielte Cricket, offene Kanäle rieselten zu unseren Füßen, in mittlerer Entfernung lagerten Eisenbahnschienen in Schuppen, und eine ganze Reihe von Betonhochhäusern stand dahinter. Eine Woche zuvor hatte ich auf dieser anderen Seite neben einem Moslem gestadden, der mir erklärte: "Von dort sind die Hindus gekommen".
Raghav erinnerte sich. Hier hatten er und seine Freunde zwei Moslems gestellt. "Wir haben sie verbrannt", sagte er. "Wir haben sie mit Kerosin übergossen und angezündet."
"Haben sie geschrien?"
"Nein, denn erst haben wir sie ziemlich verprügelt und dann verbrannt. Ihre Körper lagen zehn Tage lang im Graben und verrotteten. Krähen fraßen sie. Hunde fraßen sie. Die Polizei wollte sie nicht entfernen, weil die Polizei in Jogeshwari behauptete, sie lägen im Gebiet der Polizei in Goregaon und die Polizei in Goregaon erklärte, die Bahnpolizei sei dafür zuständig."
Raghav erinnerte sich auch noch an einen alten Moslem, der die Sena-Jungs mit heißem Wasser begoß. Sie brachen seine Tür auf, zerrten ihn heraus, nahmen die Decke eines Nachbarn, wickelten den Alten darin ein und steckten ihn in Brand. "Es war wie im Film", sagte er. "Es war still und leer, jemand brannte irgendwo, wir versteckten uns, die Armee. Manchmal konnte ich nicht schlafen, weil ich dachte, jemand könnte mich verbrennen, so wie ich jemanden verbrannt hatte."
Wir sahen uns den öden Fleck Erde an, und ich fragte ihn, ob die von ihnen verbrannten Moslems um ihr Leben gebettelt hätten.
"Ja. Sie sagten zum Beispiel: ‘Habt Mitleid mit uns!' Aber wir waren so voller Haß, und wir dachten an Radhabai Chawl. Aber selbst wenn einer von uns sagte, laßt ihn gehen, gab es zehn andere, die sagten, nein, bringt ihn um. Also mußten wir ihn umbringen."
"Und wenn er unschuldig war?"
Raghav sah mich an. "Er war Moslem", sagte er.
Einige Tage später traf ich Sunil, den stellvertretenden Leiter der shakha oder Ortsgruppe Jogeshwari der Shiv Sena. Er kam mit zwei anderen Sena-Jungs, um mit mir in der Wohnung meines Freundes einen zu trinken. Alle sahen sich anerkennend um. Die Wohnung lag im sechsten Stock auf einem Hügel, und auf der Autobahn unter uns vibrierte der Verkehr. Sunil sah aus dem Fenster. "Von hier aus kann man gut Leute erschießen", sagte er und simulierte im Rat-tat-tat-Rhythmus das Abfeuern einer Maschinenpistole. So hatte ich die Wohnung noch nie betrachtet.
Sunil war auf dem besten Weg, eines Tages die Position des pramukh, die Leitung der gesamten shakha, zu übernehmen. Zum ersten Mal war er zur Shiv Sena gegangen, als er eine Bluttransfusion benötigte. Die Sena-Jungs gaben damals ihr Blut, und das hatte ihn tief berührt, denn von da an waren seine politischen Gefährten im wörtlichen Sinn seine Blutsbrüder. Nun war er über zwanzig, hilfsbereit, großzügig und sympathisch. Er unterhält die unterschiedlichsten Kontakte zu Moslems: mit seiner Tochter geht er zu einem heiligen Moslem, um sie exorzieren zu lassen, und in der Mohammedali Road kaufte er während der Krawalle Hühner, um sie mit satter Gewinnspanne an Hindus weiterzuverkaufen. Doch jetzt erlag er der Vorstellung, jenes behinderte Mädchen, das in Rhadabai Chawl im Feuer starb, sei von ihren moslemischen Angreifern vergewaltigt worden. Dafür gab es keine Beweise. Im Polizeibericht stand nichts dergleichen. Aber darauf kam es nicht an. Es war ein überwältigendes, katalytisches Bild: ein behindertes Mädchen am Boden und eine Schlange lüsterner moslemischer Männer, die nur darauf warteten, sie zu mißbrauchen, während ihre Eltern die Schreie des Mädchens übertönten, als ihre Körper Feuer fingen.
Sunil bestand darauf, die Krawalle einen "Krieg" zu nennen. Und mit Sicherheit hatte er im J. J. Hospital kriegstypische Szenen miterlebt: Leichen, die nur anhand ihrer numerierten Schildchen zu erkennen waren. Und im Cooper Hospital, wo man Hindus und Moslems auf einer Station nebeneinander gelegt hatte, brachen des öfteren Kämpfe aus; verwundete Männer rissen dort Infusionen mit Salzlösung aus ihren Armen und bewarfen damit ihre Feinde. Während der Krawalle sandten die Behörden Milch in Tankwagen in moslemische Stadtteile. Zusammen mit drei anderen sainiks verkleidete sich Sunil als Moslem und goß in einen der Behälter tödliches Insektengift. Die Moslems aber rochen es und verweigerten die gesamte Milch. Sunils Leute sperrten den moslemischen Vierteln auch das Wasser ab. Nach sechs Tagen, so sagte er, mußten die Moslems zum großen chowk im Zentrum des Viertels gehen. "Und dort haben wir sie gekriegt", erinnerte er sich.
Ich fragte ihn: "Wie sieht ein Mann aus, wenn er brennt?"
Die anderen Männer der Sena sahen einander an. Sie mißtrauten mir noch. "Wir waren nicht dabei", sagten sie. "Die Sena hatte mit den Ausschreitungen nichts zu tun."
Aber davon wollte Sunil nichts wissen. "Ich werde es Ihnen sagen. Ich war dort", sagte er. Er sah mir in die Augen. "Ein brennender Mann steht auf, fällt, rennt um sein Leben, fällt, steht auf, rennt. Es ist entsetzlich. Öl tropft von seinem Körper, seine Augen werden riesig, riesig, man sieht das Weiße, weiß, weiß, Sie berühren seinen Arm so" - er zupfte an seinem Arm - "man kann das Weiße sehen, man sieht es vor allem auf der Nase." Er rieb seine Nase mit zwei Fingern, als kratze er die Haut ab. "Öl tropft von ihm ab, Wasser tropft, weiß, weiß überall."
"Das war keine Zeit der Besinnung", sagte er weiter. "Wir verbrannten zu fünft einen Muselmanen. Um vier Uhr morgens, nachdem wir von dem Massaker in Radhabai Chawl gehört hatten, versammelte sich eine Meute, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Männer und Frauen. Sie griffen nach jeder Waffe, die sie finden konnten. Dann marschierten wir zur moslemischen Seite. Wir trafen einen pau wallah (Brotverkäufer) auf der Straße, auf seinem Fahrrad. Ich kannte ihn, er hat mir jeden Tag Brot verkauft. Ich habe ihn angezündet. Wir übergossen ihn mit Benzin und steckten ihn in Brand. Ich dachte nur daran, daß er ein Moslem war. Er zitterte. Er weinte und schrie: ‘Ich habe Kinder, ich habe Kinder.' Ich sagte: ‘Als deine Moslems die Leute in Rhabadai Chawl töteten, hast du da an deine Kinder gedacht?' An diesem Tag zeigten wir ihnen, was das Dharma der Hindus ist."
(...)