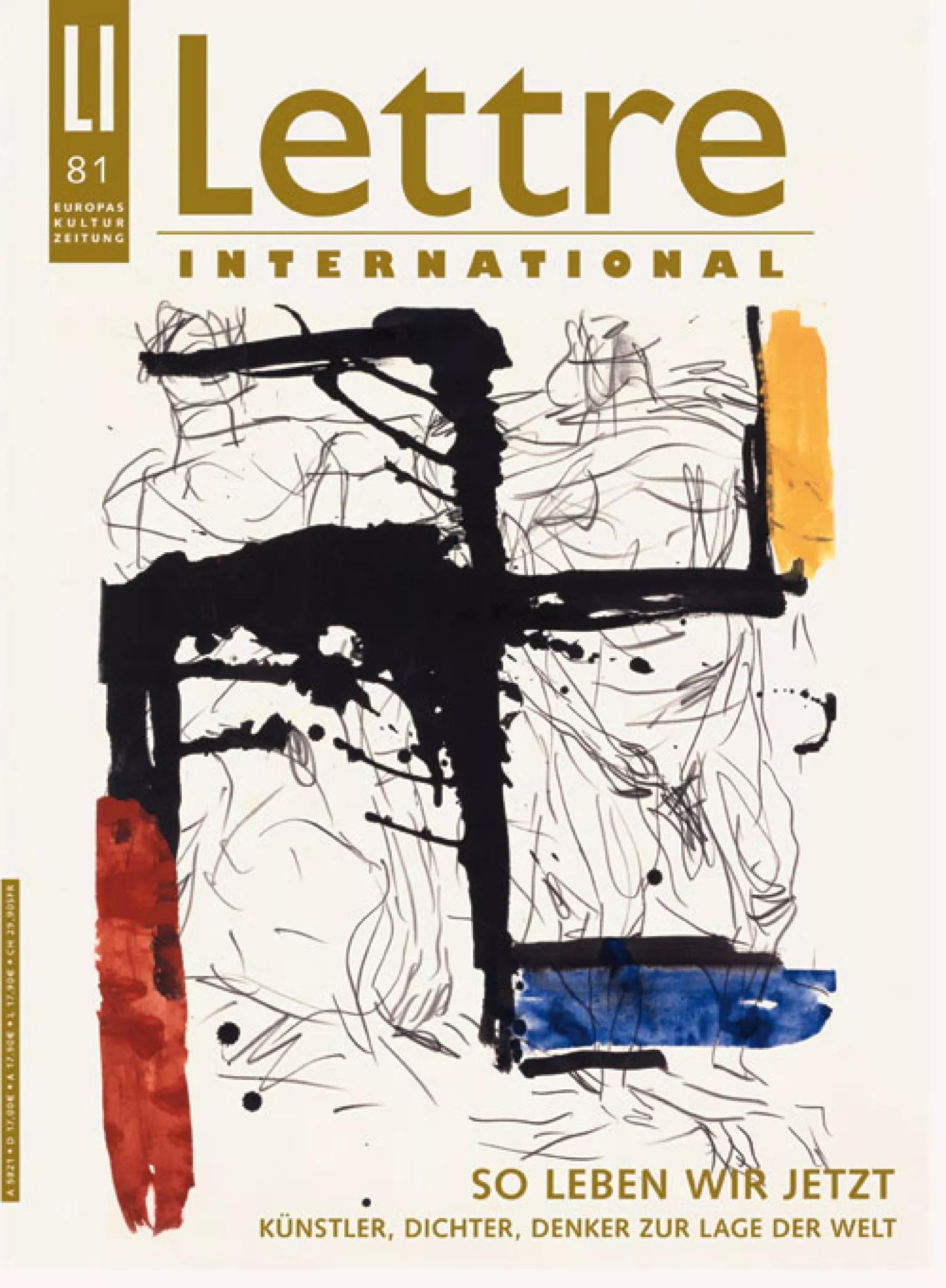LI 81, Sommer 2008
Intuition, Inspiration
Brief an Pascal Dusapin über Körper, Sinnlichkeit, Geist und ÄsthetikElementardaten
Textauszug
Lieber Pascal,
Du sprichst von Intuition, und merkwürdigerweise verstehe ich „Inspiration“. Ein Verweis auf die Homophonie genügt nicht, um die Verwechslung zu erklären … Es ist keineswegs erstaunlich, daß es in mir zu so einer musikalischen Verschiebung kommt. Dieses Thema beschäftigt mich seit geraumer Zeit. Ich mache kaum Projekte auf lange Sicht, aber ich weiß, daß mein Seminar über die Gegengeschichte der Philosophie zu Ende gehen wird, und ich denke bereits über etwas Anschließendes nach.
Um den Mangel der letzten sechs Jahre zu kompensieren, die weit ausholten, also allzuoft an der Oberfläche blieben oder sich zumindest nicht die Zeit nahmen, um tiefer zu bohren, habe ich nun Lust auf ein kurzes, knappes Thema, das mir gestattet, zwei oder drei Jahre einer eng umrissenen Frage zu widmen. Nach der Geographie der Gegengeschichte nun die Geologie dieses möglichen Themas, dem ich mich, so habe ich mir das vorgestellt, mit folgender Fragestellung widmen möchte: Wie wird man, was man ist? Das Ganze ausgehend von einer Untersuchung des Falles Nietzsche – der mit unserem „Organ der Furcht“, Du erinnerst Dich …
Daher diese Intuition-Inspiration. Wie wird man Künstler – oder auch nicht? Warum wird dieser Künstler eher in diesem Bereich aktiv und nicht in einem anderen? Picasso als Musiker, Varèse als Maler, Deleuze als Filmemacher, Gracq als Bildhauer – was würde das ergeben? Wäre das überhaupt möglich? In diese Richtung gingen meine ersten Fragen: Wie bist Du geworden, was Du (warst?) bist? Du, der Du die Photographie und die Praxis liebst, warum nicht eher Cartier-Bresson als Xenakis?
Eine bezaubernde Frage. Ich glaube, daß ein Teil der Antwort auf seiten der Neurobiologie zu finden ist. Leider verfüge ich nicht über die Mittel, um eine klare Antwort darauf zu geben, aber ich glaube, daß ein Philosoph, der sich um die Anwendung der existentiellen Psychoanalyse bemüht, heute den neuronalen Menschen und die Maschinerie der Synapsen als Ort des Gedächtnisses, des Denkens, des Erinnerns, des Genies, des Schaffens – wie auch des Scheiterns … – nicht aussparen kann. Bei dieser Antwort muß man aber vermeiden, die Henne, die goldene Eier legt, zu schlachten: Denn wenn man das Gehirn von Jean-Paul Sartre öffnet, wird man dort Das Sein und das Nichts nicht finden – das sich gleichwohl einmal dort befand …
Gerade Sartre hat die Analyse dessen, was man von einem Menschen totalisieren kann, weit getrieben. Im vorliegenden Falle im Hinblick auf Deinen Lieblingsmenschen, wie Du weißt – Flaubert. Trotz allem Corydrane, Schweiß, Alkohol, Genie, Nikotin und Whisky ist Der Idiot der Familie unvollendet geblieben. Das war Sartre zwar durchaus gewohnt, und die Liste seiner unvollendeten Werke scheint genauso lang zu sein wie die von Schubert! Ich glaube jedoch, daß das Werk deshalb unvollendet blieb, weil es an verfügbarem Material fehlte, um die Sache voranzubringen.
Ein schöpferisch tätiger Mensch ist ein Zerrissener. Und diesem Riß entströmt der Stoff, die Substanz seines Genies. Warum ein Zerrissener? Aufgrund eines Traumas – im etymologischen Sinne des Wortes: eines Schocks, eines Exzesses oder eines Mangels, vorausgesetzt, sie sind jeweils durch maximale Energie charakterisiert, eine Umwälzung, die definitive Verbindung einer Wahrnehmung mit einer Emotion, einer Empfindung mit einem Affekt, eines Signals mit einem architektonischen Sinn.
Dieser Riß generiert Temperamente und Charaktere. Bleiben wir Freudianer: Diese Sublimierungen sind entweder gesellschaftlich akzeptabel oder nicht. Im einen Fall bekommen wir den Künstler, im anderen den Delinquenten, den Verrückten, den Asozialen. Bisweilen, an der Schnittstelle, Geniale und Gefährliche (für sich selbst und für die anderen), hier findet man Sade, Lacenaire, Hölderlin, Nerval, Nietzsche, Artaud, Althusser … Auf der einen Seite der Barrikade steht der Maler, der Musiker, der Dichter, der Philosoph; auf der anderen der Vergewaltiger, der Tyrann, der Diktator, der Kriminelle. Hier die Lorbeeren des -Lexikons, dort das Register der Gefängnisse und Anstalten. In beiden Fällen gehorcht die Materie dem, was sie bestimmt, und meistens ignorieren wir den fatalen genealogischen Augenblick im existentiellen Lebenslauf eines Wesens, das nichts dafür kann.
Von nun an zeugt die Intuition von einem Loch im Sein. Dieses Trauma geht von der Welt aus, es wächst in der Realität heran und gelangt ins Gehirn, insbesondere ins Broca-Areal, das dem existentiellen Hapax entspricht: Gerüche, Farben, Töne, Geschmäcker, Rhythmen, Sinne usw. Der Eindruck in dieses unberührte Wachs zeichnet die Konturen einer Figur, die wir dann im Laufe der Zeit im Detail entdecken. Musiker, Philosoph, Schriftsteller usw. zu sein, das bedeutet, in sich selbst dem Schauspiel dieser sich allmählich vollziehenden Enthüllung beizuwohnen.
(...)