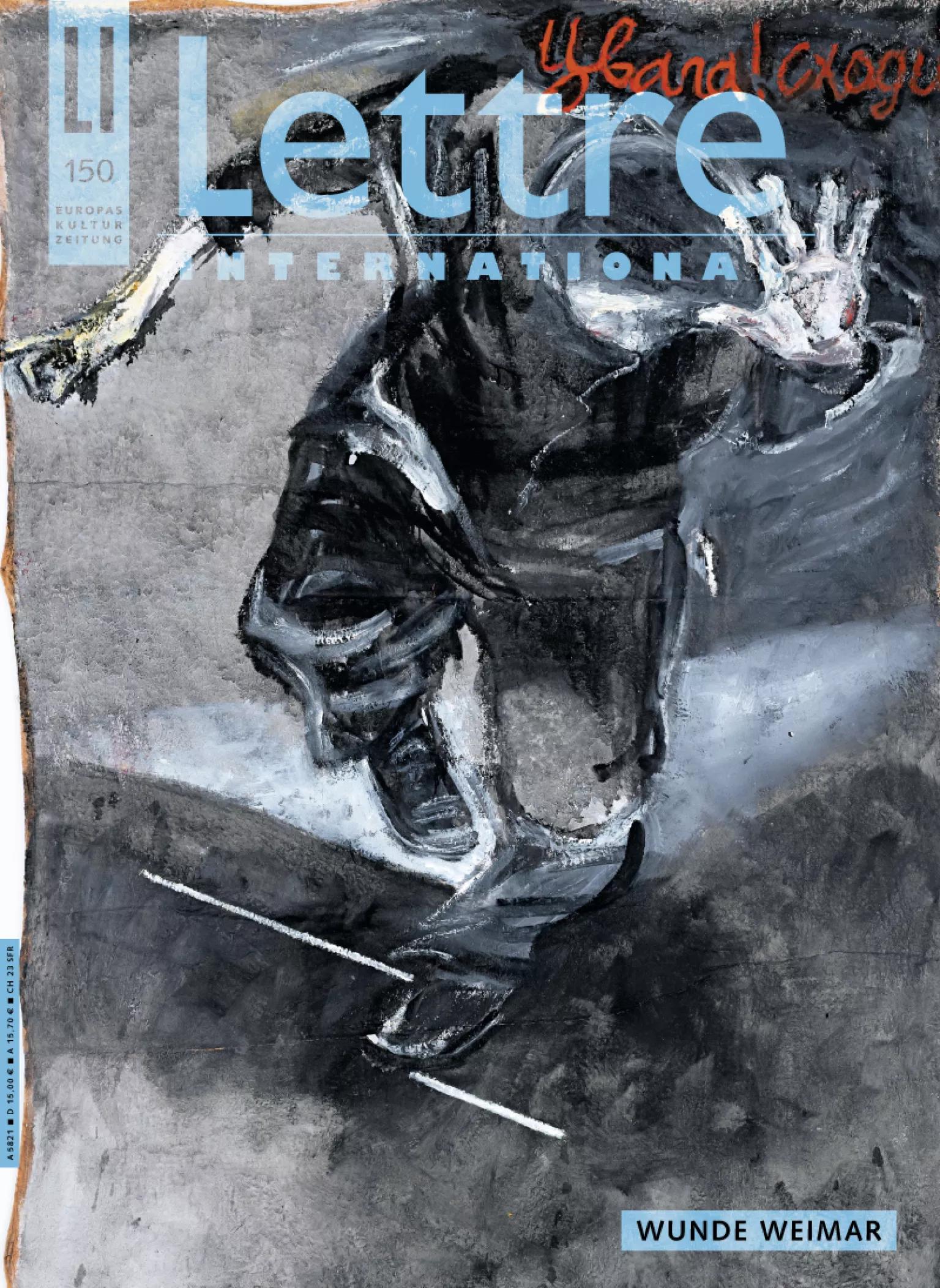LI 150, Herbst 2025
Latours Testament
Bausteine einer metabolischen Ästhetik – Kunst, Kosmologie und MoralElementardaten
Textauszug
(…)
Zweifelsohne gelingt es einem drohend erhobenen, moralisch-apokalyptischen Zeigefinger mühelos, die anthropozänen Kunstwerke mit einer Kruste aus Didaktik, Langeweile und Vorhersehbarkeit zu überziehen, doch wie soll er jene Glasur aus Zufall, Unerwartetem und Staunen anrühren, die Gaia im Licht des Unverfügbaren und einer Freude am Dasein glitzern läßt? Ein apokalyptisch konnotierter Crash von titanischen Ausmaßen zwischen der Technosphäre, als Ausdruck einer mathematischen Infrastruktur, kraft derer die Erde in einen Verfügungsraum verwandelt wird, und kollabierenden beziehungsweise revoltierenden Ökosystemen bedarf eines Kontrapunkts, der in der Realität des Planeten verankert sein muß und nicht im Wunschdenken eines Autors sowie ihn flankierender Wissenschaftler. Aus ihrer Kurzzeitperspektive verlieren die depressiv stimmenden und dabei höchst bequem mit Weltuntergangsmotiven hantierenden Bestseller-Seifenopern den planetaren Antipoden aus den Augen, wenn sie sein Verhalten in tradierte Handlungsmuster übersetzen oder das noch nicht Dagewesene mit dem Phantastischen überschreiben, statt die menschliche Praxis genealogisch in den Blick zu nehmen, welche die verstörenden planetaren Prozesse ausgelöst hat.
Daher ist es unumgänglich, den realen Kern des „Krieges gegen die Natur“ (Heiner Müller) im Jenseits der Moral freizulegen: Die linearen Maßgaben der Naturbeherrschung erweisen sich als immer weniger mit der zyklischen Verfaßtheit des Dionysischen vereinbar. Nach der Globalisierung der Natur trägt die Logik des Mechanisch-Kausalen, des Linearen, eine Fehde aus mit der Logik des Zirkulären, an deren Ende die Kultur nur den Kürzeren ziehen kann. Die Utopie der Erde appelliert laut Mbembe an die Bewohner der sozialen Gebilde, zu den „Kreisläufen und Strömen des Lebens zurückzukehren“. Kreis und Spirale, die dem evolutionären Ordnungsmodell der planetaren Abläufe zugrunde liegen, verunfallen mit einem ständig unvorhersehbare Nebeneffekte produzierenden Fortschrittsvektor, der, wie die christliche Heilsgeschichte, nur den Vorwärtsgang kennt.
Als elementare Signaturen einer lebens- und damit zukunftsaffinen Kunst stehen sie einem permanent anwachsenden ökologischen Trümmerfeld gegenüber, das aus der Diskrepanz zwischen einer dem kapitalistischen Innenraum entspringenden Wachstumslogik und den Organisationsformen planetarer Abläufe resultiert. Der Stoffwechsel der Erde wie des Lebens geht von den Jahreszeiten bis zur Wolkenbildung, als Verwandlung vom Meer- in Süßwasser, wie auch von Geburt und Tod, in Formen unendlicher Wiederholung vonstatten: „Dieser energetische Kreislauf ist nicht nur möglich, sondern notwendig, um die Zyklen des Lebendigen zu erneuern.“ Selbst Nietzsches prägnante Formel von der „ewigen Wiederkunft des Gleichen“ basiert auf dieser Einbettung des Lebens in ein zyklisches Dispositiv. Der Botschafter des Dionysos bekennt sich ohne Wenn und Aber zu dem elementaren Baustein einer planetaren Grammatik: „Ich, Zarathustra, der Fürsprecher des Lebens, ... der Fürsprecher des Kreises.“ Wie jedes ökologische Engagement, wie bewußt auch immer, unausweichlich für die „beständige Erneuerung der Zyklen des Lebendigen“ (Mbembe) votiert, so huldigten die in jedem Frühling im antiken Athen zu Ehren des Dionysos veranstalteten zeremoniellen Feiern den jährlichen Kreisläufen. Daß eine Verkennung der endlosen Zirkel- oder Spiralbewegungen des lebendigen Seins durch eine technisch hochentwickelte Kultur nicht durch Moral aufgelöst werden kann, liegt auf der Hand. Im Gegenteil: Selbst mit naturwissenschaftlichen Mitteln erzeugte Stoffe, die mit chemischer Finesse den Zersetzungskräften der Natur entzogen wurden, lassen sich mitunter nicht wieder abbauen. So konnte nachgewiesen werden, daß der in den 1930er Jahren entwickelte nahezu unzerstörbare Stoff Teflon in den Organismen, ebenso in Rebstöcken wie in menschlichen Körpern stetig anwächst. Nur weiß gegenwärtig niemand, ob und wann es zu welchen Konsequenzen kommt. Soviel zum Rätselcharakter der Wissenschaft.
(…)
Mittlerweile läßt das Unausgereifte der Technologie, ihr „Noch-nicht“ (Ernst Bloch), das holozäne Gleichgewicht der Sphären unwiderruflich kippen. Jetzt ist es Sache der Ingenieurskunst, ihre prometheischen Fähigkeiten mit Blick auf deren Stabilisierung zu entfalten und der veränderten kosmologischen Stellung des Anthropos Rechnung zu tragen. Dieser frisch aus dem anthropozänen Ei geschlüpften humanoiden Atlasfigur stehen mit der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, den Quantencomputern gewaltige zukunftsaffine Errungenschaften zur Verfügung, um das Gegeneinander von Erde und Technologie in ein Miteinander zu verwandeln.
Wie aber lassen sich – derart konstelliert – künstlerische Kraftfelder schaffen, die Offenheiten erzeugen, in denen unvorhersehbare, also nicht kalkulierte Spannungen und Stromschnellen des Ungewissen sedimentieren?
Daß ein derartiger Dreiklang erzeugt werden kann, hat Friedrich Kittler im Sommer 2010 in Lettre International 89 in dem Interview Dionysos revisited! demonstriert. Kohärent erklärt der Medientheoretiker, warum er in Jim Morrison oder anderen Rockstars mit ihren elektrischen Kitharas, pardon!, Gitarren die Wiedergänger von Dionysos und seiner Anhängerschaft erkennt; warum ekstatische, zum Tanz einladende Rhythmen mehr mit dionysischen Ekstasen zu tun haben als Formen, die orchestral abgesessen sein wollen. Qua elektrischen Strom wird ein Sound generiert, der zwischen der Haut der Erde und der Technosphäre oszilliert. In dieser Präsenzform des Dionysischen hallt ein fernes Echo jenes dionysischen Vogels nach, der in Nietzsches frühen Entwürfen noch ganzen Nationen den Weg weisen sollte. Heute, an der Schwelle der „Hervorbringung eines neuen p l a n e t a r e n B e w u ß t s e i n s“, zeugt sein Gesang von der unhintergehbaren Verschmelzung der technischen Medien und des Dionysischen. Aus dieser Perspektive erweist sich Nietzsche als der philosophische Mastermind hinter der Loveparade, bei der Hunderttausende tanzend durch die Straßen ziehen können, da das Ekstatische mittlerweile qua Lichtanlagen, Mischpulten, Projektoren etc. fest mit der Technosphäre verwachsen ist. Mit der Moderne ist die überwältigende Mehrzahl der Kunstereignisse ohne die eingesetzten Apparaturen schlicht nicht vorstellbar. Elektronische Musik, das Kino und seine Lichtspielpaläste, die Musikindustrie belegen nicht nur hinlänglich: Kunstgeschichte ist auch immer Mediengeschichte – sondern verifizieren auch Mbembes These, daß die Welt der Maschinen untrennbar mit der Zukunft der Erde und des Lebendigen verbunden ist, und seine Bilanzierung, „daß die Erde, die Technologie und das Lebendige nunmehr ein einziges und gleiches Strahlenfeld bilden“.
Die Erdzeitalter wie die Abfolge der kosmologischen Modelle belegen, daß unser Himmelskörper nicht als etwas ein für allemal Abgeschlossenes begriffen werden kann. So gesehen, verifizieren die technischen Apparaturen das Konzept der Erde als ein Offenes. Galt die Erde einst als Zentrum des Universums, bevor sie Galilei auf eine Umlaufbahn neben anderen Volumina um die Sonne verschob, versetzte 1972 das Photo der „Blue Marble“, das die Besatzung der Apollo aus dem Weltall schoß, die globale Öffentlichkeit in Staunen, wie auch die Begrenztheit unseres Orts in der Weite des Alls zugleich Beklemmungen auslöste. So zeugt die Schönheit unseres Sterns ebenfalls von der Beschränktheit und Verletzlichkeit des planetarischen Daseins.
(…)
Der Atem der Geschichte
Evident steht mit der anthropozänen Episode nicht länger der Mensch im Zentrum der Evolution. Der Planet ist das Maß aller Dinge. Und mit ihm jene Triangel, in der sich Technik, Erde und Kunst reimen. Dominierte bislang der Anthropos die Schnittstelle der Technosphäre und der Kritischen Zone, an der die massiven dystopischen Verwerfungen hervortreten, so verdeckte die Fokussierung auf den Menschen und seine momentan noch defizitär konstruierte Technosphäre die Sicht auf das eigentliche Subjekt des planetarischen Zeitalters – das Netz des Lebens mit seinen mannigfaltig gefächerten Organismen. Wodurch aber konstituieren sich die Zellen dieses Orchesters mit seinen unzähligen Akteuren als Gemeinschaft? Was zeichnet alles Leben, abgesehen von der irdischen Abkunft und zeitgleichen Präsenz, im Raum aus?
Die Kritische Zone wird allein von Gebilden bespielt, die fähig sind, sich mit ihrer Umgebung auszutauschen. Lebendige Geschöpfe sind metabolisch verfaßt, sie verfügen über einen Stoffwechsel und befinden sich permanent in Prozessen der Transformation. Mbembe spezifiziert diese Bedeutung des Metabolischen, indem er das Atmen als gemeinsame Schnittfläche zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Erdbewohnern bestimmt: „… es gibt nichts, was die Lebewesen stärker aneinander angleicht als die Atemfunktion. Die Atemfunktion teilt die menschliche Spezies mit allen anderen Lebewesen bis hin zu den Pflanzen.“ Indem sie atmen, lösen die unterschiedlichsten Organismen, der Mensch eingeschlossen, das Eintrittsticket für den Lebensprozeß. Werden essentielle Funktionen dieses metabolischen Programms unterbrochen, erlischt ihre Lizenz zur Partizipation, und die Teilnehmer wechseln ins Reich der Toten.
Die heilige Schrift der planetaren Ästhetik beginnt mit dem Satz: „Am Anfang war der Stoffwechsel.“ Ihr metabolischer Charakter definiert die „Zöglinge der Luft“ (Johann Gottfried Herder) als Akteure des zigfach verknüpften Netzes des Lebens, das alle Erdbewohner, ganz gleich in welcher Gestalt und wo, ob in der Tiefsee oder entlegenen Bergregionen, verbindet. Zugleich deterritorialisiert die Gemeinsamkeit des Atmens die Grenzziehungen zwischen den unterschiedlichen Sphärenbewohnern und stiftet ein planetares Plateau jenseits des Anthropozentrismus, auf dem sich die Akteure des Lebensprozesses trotz aller offenbaren und weniger signifikanten Unterschiede versammeln.
Mit dem Atem als verbindender Grundlage aller Lebewesen enträtselt Mbembe eine utopische Chiffre, auf die Nietzsche mehrfach rekurriert, ohne das Enigmatische dieser Komposition analytisch aufzulösen. Wie der Satyr als tanzender Choreut und ekstatisch gestimmter Akteur des tragischen Kunstwerks die Einheit der Natur offenbart, propagiert das dionysische Traumbild, so Nietzsche, die Versöhnung in und mit der Natur: „friedfertig nahen die Raubthiere der Felsen und der Wüste. Mit Blumen und Kränzen ist der Wagen des Dionysus überschüttet: unter seinem Joche schreiten Panther und Tiger.“ Wenn Mbembe von der Utopie der Erde spricht, feiert der dionysische Festzug, der Flora wie Fauna umspannt, das terrestrische Kollektiv jenseits aller naturalistischen Realitäten. Der Atem weist als gemeinsame Währung der Erdbewohner eine nicht zu leugnende Schnittmenge mit dem Dionysischen auf, während religiöse Konzepte, inklusive Auferstehung und Erlösung vom Tode, nie ohne die Spekulation einer – das alte Ägypten eingerechneten – viertausendjährigen Jenseitshypothese auskommen.
(….)