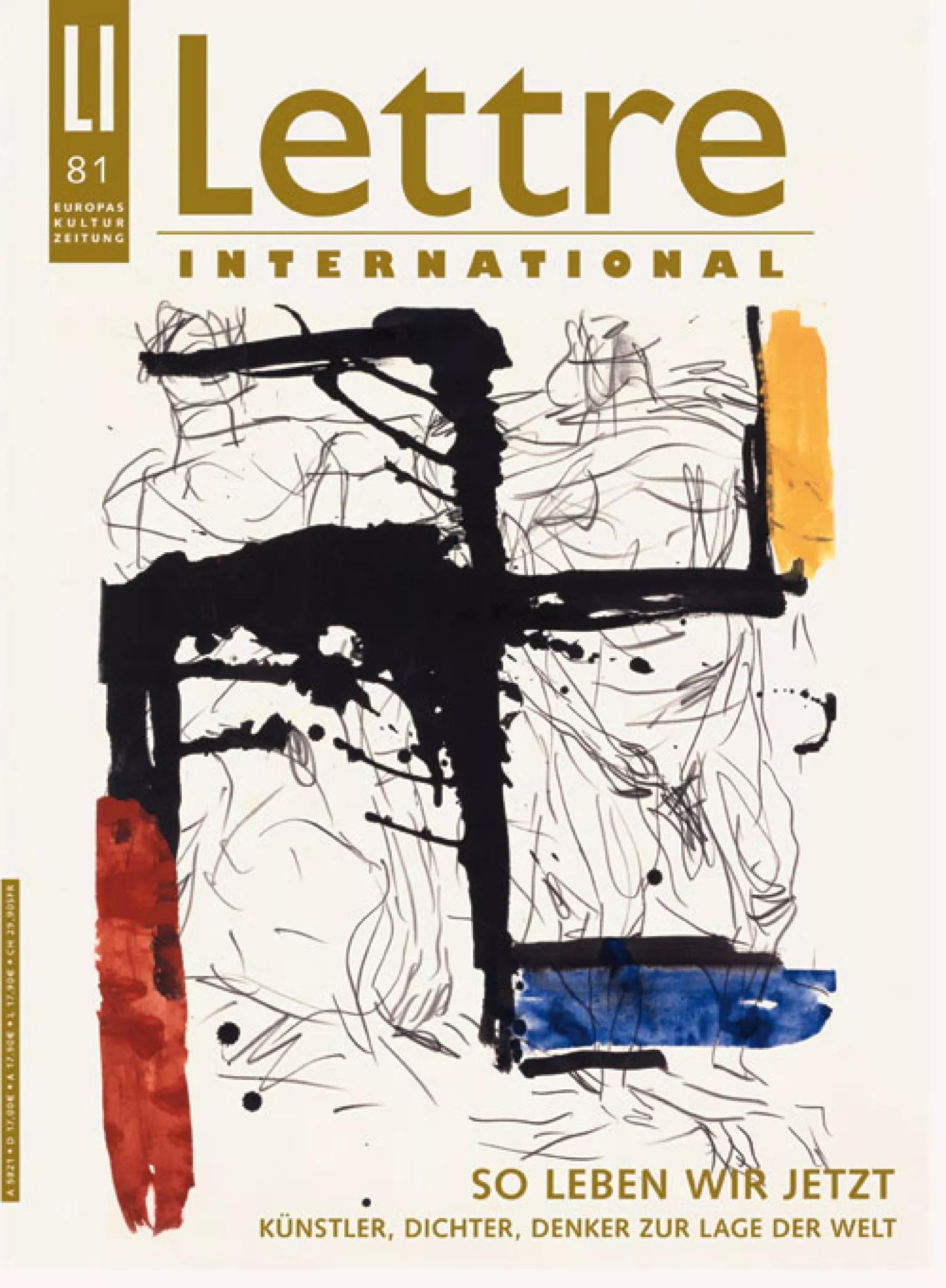LI 81, Sommer 2008
Spuren im Sumpf
Elementardaten
Genre: Meditation, Reportage
Übersetzung: Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Textauszug
„Wo sind wir jetzt, Buck?“
„Wir nähern uns einem der wildesten Winkel aller Meere der Welt, Kumpel.“
Ich bin an Bord des Hummerfängers „Velocity“, und wir halten auf Tasmaniens Südspitze zu. Regen peitscht nieder, eine drei Meter hohe Dünung wirft hohe Gischtwogen auf, und der Wind fegt mit 140 Stundenkilometern über das Deck.
Das Südwestkap ist umrundet, und langsam stampfen wir nordwärts, Tasmaniens tückische Westküste entlang. Ein unfaßbar frischer, sauberer Wind, der ungehindert 16 500 Kilometer weit von der nächsten Landmasse, von Feuerland, herüberweht, gibt eine pausenlose Breitseite auf uns ab.
Ich klammere mich an die Reling und blicke mit zusammengekniffenen Augen über die grauen Wellen auf uralte Quarzitfelsen, Buttongrasebenen und die Konturen der hinter uns zurückbleibenden Berge – heute nur noch eine unbewohnte Wildnis.
„Schon mal hier gewesen?“ frage ich Buck mit seinem langen Prophetenbart, dem roten Hemd einer australischen Football-Mannschaft und der halbleeren, Langhals genannten Bierflasche in der Hand.
Er lacht verächtlich. „Schon oft. Ich komme immer wieder in diese Gegend, Kumpel, weil ich mir ansehen will, wo der Aborigine in mir herkommt.“
Das Land, das ich im Regen kaum ausmachen kann, war bis vor nicht allzu langer Zeit noch von Bucks Vorfahren besiedelt, jenen tasmanischen Ureinwohnern, die seit der letzten Eiszeit auf dieser Insel gelebt hatten. (Buck stammt außerdem von einem im 19.Jahrhundert eingewanderten schottischen Matrosen namens Brown ab.) 1803 kamen dann die Briten, und innerhalb einer einzigen Lebensspanne waren die tasmanischen Ureinwohner tot, allesamt, ohne Ausnahme. Ihr Schicksal, ihre rasche Auslöschung, erscheint mir zunehmend beispielhaft für das, was die übrige Menschheit erwartet, sollten wir nicht unverdient Glück haben. Mir fällt ein Plakat an der Straße ein, daß ich auf der Fahrt zur „Velocity“ gesehen habe, eine Warnung an alle rücksichtslosen Autofahrer. Eine Hand, schnippende Finger und die Worte: „Einfach so."
Der Wind sprüht Gischt über das Deck. Ich klammere mich fester an die Reling, atme tief ein und fülle meine Lungen mit der verbrieftermaßen reinsten Luft dieser Welt.
Folgt man den uralten Felsklippen nach Norden, kommt man zur Cape Grim -Baseline Air Pollution Station, die 1970 meldete, dieser Wind – eingefangen in Behältern wie „fette Glaswürste“ – sei die „sauberste je auf Erden gemessene Luft“. Die Meßstation ist eine von 22, die Veränderungen in unserer Atmosphäre prüfen. Cape Grim mag am Ende der Welt liegen, doch sind die auf dem gut hundert Meter hohen Felsgipfel herausgefilterten Informationen für unseren ganzen Planeten von Bedeutung.
Als ich das letzte Mal mit der leitenden Wissenschaftlerin Jill Cainey sprach, durfte sie keine Aussagen zum Klimawandel machen, da Australien das Kyoto-Protokoll nicht unterzeichnet hatte. (Das tat es erst in diesem Jahr.) Allerdings konnte sie mir sagen, daß die Konzentration von Kohlendioxid von 330 Teile pro Million im Jahre 1983 auf 372 Teile pro Million im Jahre 2003 gestiegen war. Gefährlich, sagte sie, wird es ab 400. Als ich mich jetzt, fünf Jahre später, erneut mit Cainey unterhalte, einer bescheidenen, unaufdringlichen Engländerin, sagt sie, der Wert seit um weitere 10 Punkte auf 382 Teile pro Million gestiegen. Und diesmal zeigt sie in dem, was sie zu sagen hat, keine Zurückhaltung.
Cainey ist in meinem Alter und wuchs in Nord-england mit der in unserer Generation verbreiteten Ansicht auf, die Natur würde schon mit dem fertig, was wir ihr zumuten. Wir warfen nicht bloß Plastiktüten, sondern auch unseren Giftmüll und radioaktiven Abfall in die Meere – oder wir verpesteten die Luft und verbrannten das Zeug einfach. Wir testeten Wasserstoffbomben, holzten ganze Wälder ab, betrieben Raubbau an unserem Planeten und glaubten, er würde schon auf die eine oder andere Weise damit zurechtkommen. Allein im Laufe meines Lebens aber hat sich herausgestellt, wie groß unsere Ignoranz wirklich ist. 60 000 Jahre brauchte die Menschheit seit ihren Anfängen in Afrika, um einzusehen, daß es Grenzen dessen gibt, was wir unserer Umwelt zumuten dürfen, doch scheint unser Wissen damit auch schon an sein Ende gekommen zu sein. „Wir wissen nur, über wie viele Vorgänge wir nichts wissen“, sagt Cainey im Laufe eines Gespräches, das für mich zu den wichtigsten gehört, an die ich mich erinnern kann. Ich notiere mir das Datum: 23. April 2008.
Der Klimawechsel, den wir heute feststellen, so Cainey, ist eine Folge des Kohlendioxidausstoßes von gerade mal dreißig Jahren. Die jüngsten Emissionsmessungen von Cape Grim zeigen, daß wir unser Verhalten nicht geändert haben, ganz im Gegenteil. „Wir führen ein Experiment durch, wie es sich größer kaum denken läßt, und haben keine Ahnung, was dabei herauskommen wird.“
Cainey findet, Australien sei in dieser Hinsicht einzigartig, da hier die Folgen des Klimawandels unmittelbar zu sehen sind. Einige Kilometer hinter Cape Grim hat der ansteigende Meeresspiegel bereits dafür gesorgt, daß Landstriche rund um Circular Heads zu salzhaltig wurden, um sie noch länger landwirtschaftlich nutzen zu können. Aber -Cainey machen nicht nur die Folgen der Eisschmelze Sorgen. „Wir haben keine Ahnung, wie das Plankton reagiert, wenn der Salzgehalt der Ozeane fällt, wie Bäume und Wälder darauf reagieren, wie das Getreide.“ Ein Beispiel. Die Meere werden säurehaltiger, also geht die Planktonproduktion zurück. „Folglich gibt es weniger Krill, also auch weniger große Fische.“ Bleibt noch die Tatsache zu erwähnen, daß die Meeresströmungen unser Wetter beeinflussen. „Letztens hatte ich jemanden bei mir im Büro, der den Klimawandel für Blödsinn hält, aber ob man glaubt, daß klimatische Veränderungen ein Problem bedeuten, hängt größtenteils davon ab, ob man Wasser hat. Hat man Wasser, glaubt man nicht, daß es ein Problem gibt. Hat man kein Wasser, ist man allerdings davon überzeugt.“ Die Bauern an der tasmanischen Ostküste (wo ich im Winter wohne) haben seit einem Jahr keinen Regen mehr gehabt. Sie wissen, wie groß das Problem ist. Cainey fährt fort: „Langfristig gesehen wird es die Erde sicher noch geben, die Frage ist nur, wieviel Leben wir mit in unseren eigenen Untergang reißen. Wenn wir nicht in den nächsten zwei bis fünf Jahren unser Verhalten ändern und den Kohlenstoffausstoß begrenzen, ist es vermutlich zu spät.“ Ich wiederhole diesen Satz, da ich dieses Todesurteil so zuvor noch nicht gehört habe: Wenn wir nicht in den nächsten zwei bis fünf Jahren unser Verhalten ändern und den Kohlenstoffausstoß begrenzen, ist es vermutlich zu spät. Diskussionen über einen Zehnjahresrahmen etwa für die vermehrte Nutzung von Kernkraft können da wohl kaum die Lösung sein.
Wenn Cainey von „unserem Verhalten“ redet, meint sie das Verhalten jedes einzelnen, doch findet sie, entwickelten Gesellschaften obliege die Verantwortung, bevölkerungsreichen Ländern wie Indien und China zu helfen (die gegenwärtig jede Woche zwei neue Kohlekraftwerke bauen). „Wir tragen die Verantwortung für die Emissionen der Vergangenheit, müssen künftigen Kohlendioxidausstoß reduzieren und Entwicklungsländern helfen, ihre Ziele zu erreichen. Man darf die anderen Länder auf ihrem Weg nicht bremsen. Wir haben Hilfestellung zu leisten. Die reichen Länder konnten ihren Sprung nach vorn schließlich schon machen, und wir besitzen die nötigen Voraussetzungen, anderen zu helfen.“
Hinsichtlich der raschen und radikalen Veränderung unseres Verhaltens, so dringend sie auch sein mag, ist Cainey nicht sonderlich optimistisch. „Vor zwei Wochen war ich in Neuseeland zum Treffen einer Arbeitsgruppe Kohlenstoff und bin ziemlich deprimiert zurückgekommen. Wie lange man doch braucht, um sich auf den genauen Wortlaut eines gemeinsamen Statements zu einigen – ob es nun ,menschliche Ursache‘ oder ,natürliche Variation‘ heißt, scheint wichtiger zu sein, als etwas zu unternehmen. Wir revidieren Worte, statt unser Verhalten zu revidieren.“
Cainey beschreibt unsere Lage mit einem Bild: „Wir sitzen auf offenem Wasser in einem Kanu, weit und breit kein Land in Sicht. Das Kanu schlägt leck, aber wir bleiben sitzen und diskutieren, ob wir das Loch nun mit einem Lappen oder einem Stück Holz stopfen sollen, dabei kann nur eines passieren, wenn wir uns nicht um das Leck kümmern: Das Kanu geht unter. Wir streiten darüber, was wir tun sollten, tun aber nichts.“
Sie pflichtet mir bei, daß das, was zum Schmelzen der Gletscher Grönlands und der Antarktis führt, vergleichbar sei mit dem, was den Ureinwohnern Tasmaniens widerfuhr. „Das haben wir denen angetan, und jetzt tun wir es der ganzen Welt an.“
Mit anderen Worten: Leben wir so weiter wie bisher, haben wir bald keine Geschichte mehr zu erzählen.
(...)