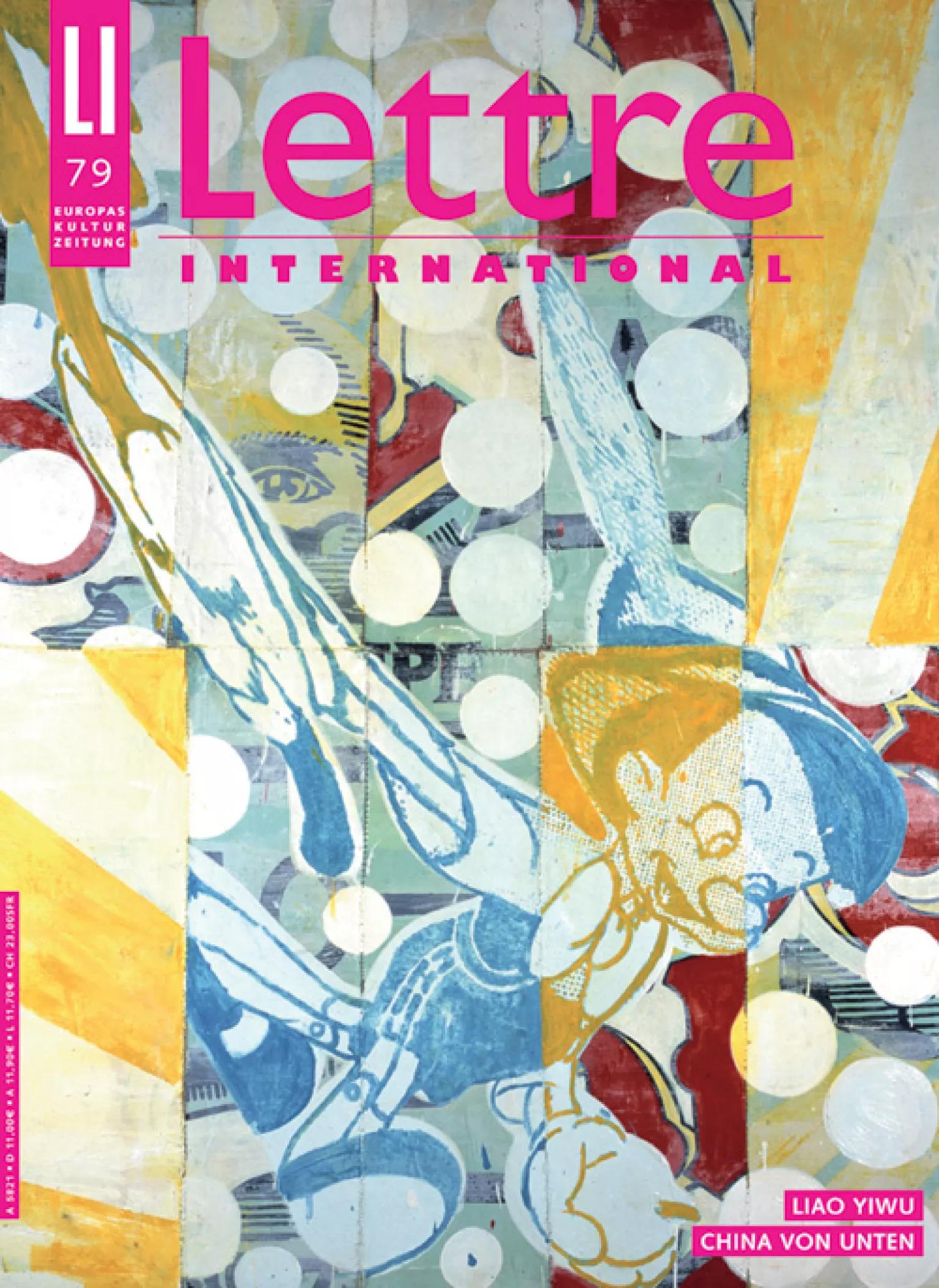LI 79, Winter 2007
Walter Benjamins Grab
Schönheit, Tod, Namenlosigkeit - Profane Illuminationen in PortbouElementardaten
Textauszug
(…) Als wir später auf dem Friedhof selbst nach einem Hinweis auf Benjamin suchten, fanden wir einen etwa hüfthoch aus dem Boden aufragenden Findling, naturbelassen, nur mit einer Platte versehen, die ein weiteres Zitat aus Benjamins Schriften trug. Seine Texte scheinen viele für Grabsteine und Denkmale geeignete prägnante Sprüche zu enthalten, und es fehlt auch nicht an Autoren, die im Streben nach geisterhafter Tiefe den einen oder anderen in ihre Texte montieren. Armer Benjamin. Seine Perlen so vor die Säue geworfen zu sehen. Der Satz lautete: „Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.“
Zunächst hielten wir das für den Grabstein, unter dem Benjamins Gebeine lagen. Doch später ging mir auf, wie naiv das war, konnte das gewichtige kleine Monument doch eine Irreführung ohne Leichnam darunter sein, zumal ein Name, sogar ein in Stein gemeißelter, nichts als Schall und Rauch ist und ziellos den Launen der Zeit ausgeliefert durch die Lüfte fliegen kann wie ein Papierschnipsel durch eine windige Gasse. Doch Friedhöfe sollen zumindest den Anschein eines direkten Zusammenhanges zwischen Name und Leichnam erwecken, und auf diesem Prinzip beruht ja auch unsere Sprache selbst, die Wörter auf Bedeutungen festlegt, als bestünde ein innerer Zusammenhang zwischen beiden – eine Form von Magie, wie Benjamin nicht müde wurde zu betonen.
In der Tat gehört diese Magie zu seinen grundlegendsten und fruchtbarsten Einsichten, die er 1933 in dem Essay Über das mimetische Vermögen ausschöpfte, geschrieben auf der Insel Ibiza – die ebenso wie Portbou in der katalanischen Kulturgeschichte eine bedeutende Rolle spielt, obwohl sie acht Bootsstunden von der Grenzstadt entfernt südostwärts im Mittelmeer liegt. Benjamin verbrachte zwei Sommer auf Ibiza, wo auch sein legendärer Essay über den Erzähler keimte. Er traf dort, verarmt und heimatlos, am 19. April 1932 ein, also ebenso wie wir in Portbou mitten im Frühling. Die Blumenpracht und Schönheit der Insel überwältigten ihn. Manchmal erschien sie ihm wie ein urgeschichtliches Paradies, ein Ausflug in die ferne Vergangenheit vor den Anfängen der europäischen Zivilisation.
Da Photos von Benjamin selten sind, prangt auf Buchumschlägen immer wieder das gleiche grüblerische Gesicht, mal mit, mal ohne Zigarette. Welch eine Überraschung, ihn einmal am Strand zu sehen! Im Sommer. Auf Ibiza! Es gibt Gruppenbilder im Querformat, die ihn vor dem Hintergrund eines Strandabschnitts mit Sand und zerklüfteten Felsen zeigen. Doch während seine beiden männlichen Begleiter weiße Unterhemden tragen und die Sonne genießen, sitzt Benjamin todernst in Schlips und Kragen auf seinem Liegestuhl, das Kinn wie üblich auf die rechte Faust gestützt, und blickt ins dunkle Innere des Hauses anstatt auf den Strand und das Meer hinaus.
Allerdings findet sich im Benjaminschen Photoarchiv ein Bild, mit dem niemand – ja wirklich niemand – hätte rechnen können. Da sind – im Mai 1933! – vier herrlich entspannte Männer, die sich an Deck eines Bootes unter gespanntem Segel und vor schäumendem Kielwasser sonnen: -Benjamin und ein Enkel Paul Gauguins nebeneinander auf dem Rücken liegend, überragt von dem mit freiem Oberkörper auf der Bordkante sitzenden, engelsgleichen französischen Maler Jean Selz, dahinter am Ruder der ebenso verzückte örtliche Fischer Tomás Varó („Frasquito“) – wie es scheint, allesamt völlig bekifft. Doch wie wäre dann der hintergründige Untertitel zu verstehen, „Der Autor als Produzent“, den die amerikanischen Herausgeber der ausgewählten Schriften Benjamins für die Szene wählten? Ich habe ihn beim Wort genommen und das Photo an die Tür meines Schlafzimmers gehängt, in dem ich auch produziere.
Die Sonnenglut erschreckt ihn. Später wird er den fiebrigen Essay In der Sonne schreiben, der zugleich ein Liebesbrief an eine enge Freundin in Berlin ist. „Nur mit Befremden ruft er sich ins Gedächtnis, daß ganze Völker – Juden, Inder, Mauren – ihr Lehrgebäude unter einer Sonne sich errichtet haben, die ihm das Denken zu wehren scheint.“ Diese Sonne sengt sich in die Landschaft ein und formt sie unerbittlich. Eine Hummel schlägt an sein Ohr. Düfte von Harz und Thymian schwängern die Luft. Seine Wahrnehmung verändert sich, als er über die Beziehung zwischen Namen und Dingen nachdenkt, über die Namen der 17 Arten von Feigen, die es auf der Insel geben soll. Seit seinem aphoristischen Jugendwerk Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen hat er dieses Thema nicht mehr aufgegriffen, um nun wiederum ehrfürchtig zuzuschauen, wie aus dem Weben der Natur sich Namen lösen, die wortlos in ihn eintreten und die er erkennt, während seine Lippen sie formen. Sie tauchen in der namenlosen Ferne auf, zum Beispiel als „Namen der Inseln, die dem ersten Anblick wie Marmorgruppen aus dem Meer sich hoben“.
Neben Namen von Dingen beschwor die Insel auch Geschichten herauf. Schon bei der ersten Überfahrt auf einem Frachtdampfer, die von Deutschland aus elf Tage dauerte, hatte Benjamin über das Verhältnis von Erzählen und Langeweile nachzudenken begonnen und befunden, daß es ohne sie keine wirkliche Erfahrung gebe und damit keinen Platz mehr für den Erzähler als einen „Mann, der dem Hörer Rat weiß“. Gleichzeitig habe er vom Kapitän so viele Fingerzeige erhalten, daß bei der Ankunft der ganze Schiffsbetrieb, von der Besatzung über die Maschinen bis zu den Seekarten, ihm wie ein „Zifferngeschiebe“ vorschwebte und er im Geiste die Geschichte der Reederei bis auf die Zeiten des Sklavenhandels zurückverfolgen konnte. „Langsam bewegte sich das Gespräch“, erinnerte sich Benjamin, „wie eine Lunte aber glomm es immer wieder auf ein Abenteuer, eine Geschichte zu.“
„Nicht viele könnte ich wiedererzählen“, bekannte er, „aber keine war da, aus der mir nicht ein Name oder ein Bild vor Augen stand, als ich die Treppe hinunterlief, um vor der Abfahrt noch ein paar Worte mit dem Kapitän zu tauschen.“
Sein Schreiben zielte darauf ab, den Abstand zwischen den Wörtern und dem Angepeilten aufzuheben. Darauf wies besonders Theodor Adorno hin, als er lange nach Benjamins Tod schrieb: „Unter dem Blick seiner Worte verwandelte sich, worauf immer er fiel, als wäre es radioaktiv geworden.“ Epistemologisch formuliert heißt das: „Der Gedanke rückt der Sache auf den Leib, als wollte er in Tasten, Riechen, Schmecken sich verwandeln.“
Wenn sich dagegen auf dem Friedhof von Portbou die Namen von den Leichnamen lösten, so zerrten sie auch an den Haltetauen der Sprache und machten die Kennzeichnung des Todes zu einem Kernproblem im Sinne von Benjamins Sprach-theorie. In seinen Kindheitserinnerungen Berliner Chronik, die ebenfalls zum Teil 1932 auf Ibiza entstanden, schrieb Benjamin: „Die Sprache hat es unmißverständlich bedeutet, daß das Gedächtnis nicht ein Instrument zur Erkundung der Vergangenheit ist, sondern deren Schauplatz. Es ist das Medium des Erlebten wie das Erdreich das Medium ist, in dem die toten Städte verschüttet liegen.“ In diesem müsse man graben und graben, um die wahren Werte, die im Erdinneren steckten, zutage zu fördern: „die Bilder, die aus allen früheren Zusammenhängen losgebrochen als Kostbarkeiten in den nüchternen Gemächern unserer späteren Einsicht – wie Trümmer oder Torsi in der Galerie des Sammlers – stehen.“
(…)