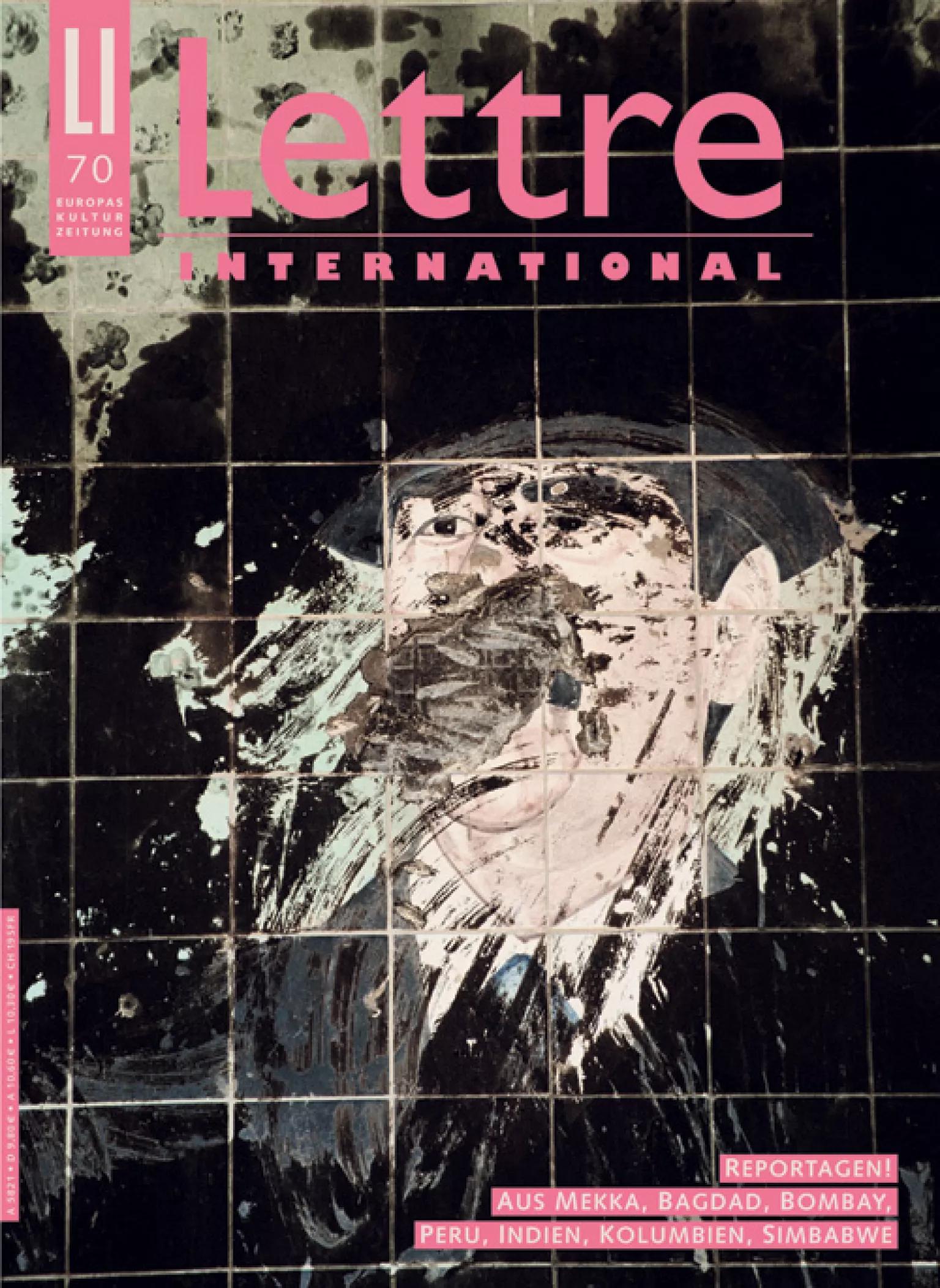LI 70, Herbst 2005
Verhöre in den Anden
Wo sich ihr Traum erfüllte: Für die Revolution zu sterbenElementardaten
Genre: Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Spanischen von Ulrich Kunzmann
Textauszug
Jesus Sosa veränderte sich in Totos außerordentlich schnell. Als sein Aufenthalt im September 1983 endete, hatte er beinahe alles mitgemacht, was man von einem in der Subversionsbekämpfung eingesetzten Armeeangehörigen erwarten konnte: Gefangennahmen, Verhöre, Hinrichtungen, Spähtruppunternehmen, Zusammenstöße und Hinterhalte. Der ständige Kontakt mit den Gefangenen und die Märsche durch die Landgebiete gaben diesem Zeitraum eine brutale Erlebnisdichte, füllten ihn mit so vielen blutrünstigen Episoden, daß sie einen Mann fertigmachen konnten. Aber Jesús Sosa hielt durch. Wie Schakal war er offenbar nicht dazu verurteilt, in die psychiatrische Abteilung des Armeelazaretts eingeliefert zu werden – ein Schicksal, das viele Offiziere der Unruhegebiete traf.
Während dieser Zeit verhörte Jesús Sosa ungefähr 200 angebliche Sendero-Kämpfer am Stützpunkt. Kommandant Pato hatte vierzig bis fünfzig von ihnen aus Ayacucho hergeschickt. Logischerweise hatte man die meisten bei den Spähtruppunternehmen im Zuständigkeitsbereich des Stützpunkts verhaftet, der außer den bereits genannten Orten Veracruz, Vilcanchos, Chuschi, Tucu, Sachabamba, Quispillacta, Paras und Cancha Cancha auch Espite, Patahuasi, Potrero, Condorpacha, Huanu Huanu, San Juan de Cucho Quesera, Pucaccasa, Viscachayo und andere Gemeinden umfaßte, in denen viele Personen festgenommen wurden. Wie wir gesehen haben, kamen nicht alle am Stützpunkt an; wenn sie aber einmal dort waren, wurden sie zunächst verhört und dann hingerichtet, was entweder Paz oder Schakal befahl, je nachdem, woher sie kamen. Niemand verließ die „Trauminsel“ lebend. Ausgenommen zwei Häftlinge, die, obwohl sie gefesselt waren und eine Kapuze trugen, durch ein Loch entkamen, das sie in die Luftziegelwand der Zelle gebohrt hatten. Als man ihre Flucht einige Minuten später entdeckte, konnten die Patrouillen sie im nächtlichen Dunkel nicht entdecken.
Jesús Sosa wurde ein Fachmann für die Hinrichtung von Gefangenen. Als Vierundzwanzigjähriger hatte er in weniger als zwei Monaten die nötigen Fertigkeiten entwickelt, damit diese Aktionen schnell und unauffällig vonstatten gingen. Der Gefangene mußte nach einem einzigen Schuß in die Schläfe augenblicklich sterben, und das möglichst, wenn er nicht darauf gefaßt war. Ohne Zuckungen, ohne Lärm. Der Einsatz der Soldaten oder eines unerfahrenen Unteroffiziers hatte bei so etwas gewöhnlich verheerende Folgen. Es konnte passieren, daß sie den Körper mit FAL-Feuerstößen zerfetzten oder auf die falschen Körperteile schossen, so daß weitere Salven notwendig wurden. Auch wenn man sie begrub, verlangte das Planung und vorbereitende Arbeiten – man mußte im voraus Gräber ausheben – sowie einen tadellosen Abschluß, indem man das Ganze mit einer dicken Schicht aus Steinen und Erde bedeckte.
Für diese Recherche wurde Jesús Sosa vier Jahre lang – zwischen 1997 und 2000 – vom Autor befragt. Im Lauf der Jahre kamen wir immer wieder auf dieselben Szenen zurück, und der schwierigste Punkt war die Tötungsbereitschaft des Agenten, denn die Wahrheit schien sich in unterirdischen Tiefen zu verbergen, und dies auch noch unter der Voraussetzung, daß Sosas Erklärungen vollständig aufrichtig und wahrheitsgetreu waren. Wie er es darstellte, war seine Rolle als Vernehmer in Totos auf einen zufälligen Umstand zurückzuführen: Man gab ihm Goytizolos Platz, vielleicht, weil er gesunden Menschenverstand und Geistesgegenwart bewiesen hatte, als er in den wenigen Wochen, die er in Huamanga verbracht hatte, mit Gewalttaten fertig wurde, oder vielleicht auch, weil er ordentlich und verantwortungsbewußt war. Auf keinen Fall geschah es allerdings wegen seiner Erfahrung. Nie hatte er mit einem Sendero-Kämpfer zu tun gehabt, und möglicherweise hätte ein anderer Agent, wenn er an Sosas Stelle gewesen wäre, diese Arbeit besser ausgeführt. Nun aber, da er in Totos war und sich um die Gefangenen kümmern mußte, zeigte sich für seine Vorgesetzten eindeutig, daß er die Dinge gut erledigte. Schakal mußte sich nicht über ihn beschweren. Und er auch nicht über Schakal. Im Gegenteil: Er lernte viel, indem er ihm bei der Arbeit zusah. Mit seiner persönlichen Autorität und seiner Großzügigkeit wurde Hauptmann Santiago Picón Pesantes bald zum Führer des Agenten.
Wenn man sich weiter an Sosas Darstellung hält, war seine Rolle bei den Hinrichtungen andererseits auf mehrere Eigenschaften zurückzuführen, die nichts mit Grausamkeit zu tun hatten. Vor allem hielt er die Spannung aus, die die Tötung eines anderen Menschen mit sich brachte, und er konnte auch lästige Verwaltungsangelegenheiten übernehmen. War er deshalb abnorm veranlagt oder einfach jemand, der ein größeres Talent für gewisse militärische Aufgaben besaß? Etwas zeigte sich eindeutig: Einen psychologischen Schutz bei seinen Handlungen bot ihm das militärische Wertsystem, nämlich die absolute Disziplin, mit der er dem Befehl des Oberkommandos gehorchte, Vaterlandsfeinde zu vernichten. Es hätte Verrat bedeutet, wenn er diesen Befehl mißachtet hätte. Hingegen war es verdienstvoll und ein Anlaß zu berechtigtem Stolz, wenn man den Befehl vollständig ausführte.
Gleichzeitig vereinbarte er innerlich seine Handlungen mit der christlichen Gesinnung, an die er sich gebunden fühlte. „Ich glaube nicht, daß Gott diese Scheißterroristen unterstützt“, sagte er sich, wenn er ernsthaft nachdachte. Das war die Grundfrage: Mußte man Sendero-Kämpfer töten oder nicht? „Selbstverständlich, ja“, dachte der Agent. Er nahm sich nicht vor sich selbst in Schutz, indem er behauptet hätte, daß er seine soldatische Pflicht erfüllte, obwohl das stimmte. Er fühlte, daß er eine höhere Verantwortung übernahm. Das war eine Verantwortung den anderen gegenüber, eine selbstlose und gefährliche Aufgabe, bei der ihm, wie er es empfand, nicht nur die Armee beistand. Auch Gott half ihm, gab ihm Kraft und verzieh ihm.
Nachdem er diesen Punkt geklärt hatte, daß es notwendig war, Sendero-Kämpfer zu beseitigen, blieb noch die Frage, wer einer war und wer nicht. Dann kam ein weiterer Punkt ins Spiel: daß man sich irren und Gerechte anstelle der Sünder töten konnte. Das war ein unlösbares Problem, ein Preis, den man unverzagt bezahlen mußte. Unter den Umständen, die die Arbeit am Stützpunkt bestimmten, erwies es sich als unmöglich, vollständig sicher zu wissen, ob die Festgenommenen schuldig waren. Das durfte ihren Tod nicht verhindern. Falls man einen angeblichen Unschuldigen freiließe, der danach erzählen würde, was er erlebt hatte, hieße das, sich einem äußerst großen Risiko auszusetzen und einen möglichen Beweis bestehen zu lassen, daß das Militär kriminelle Handlungen beging, womit man die gesamte Subversionsbekämpfung gefährdet hätte.
Wenn daher ein wahnsinnig gewordener oder betrunkener Offizier eine ordnungswidrige Tötung verschuldete, war diese unvorhergesehene Tat – mit ihrer Grausamkeit und ihren Mißhandlungen – nicht der wahre Grund für den Todesfall. Das Schicksal des Festgenommenen stand von vornherein fest, es hatten sich nur der Tag und die besonderen Umstände geändert.
(...)