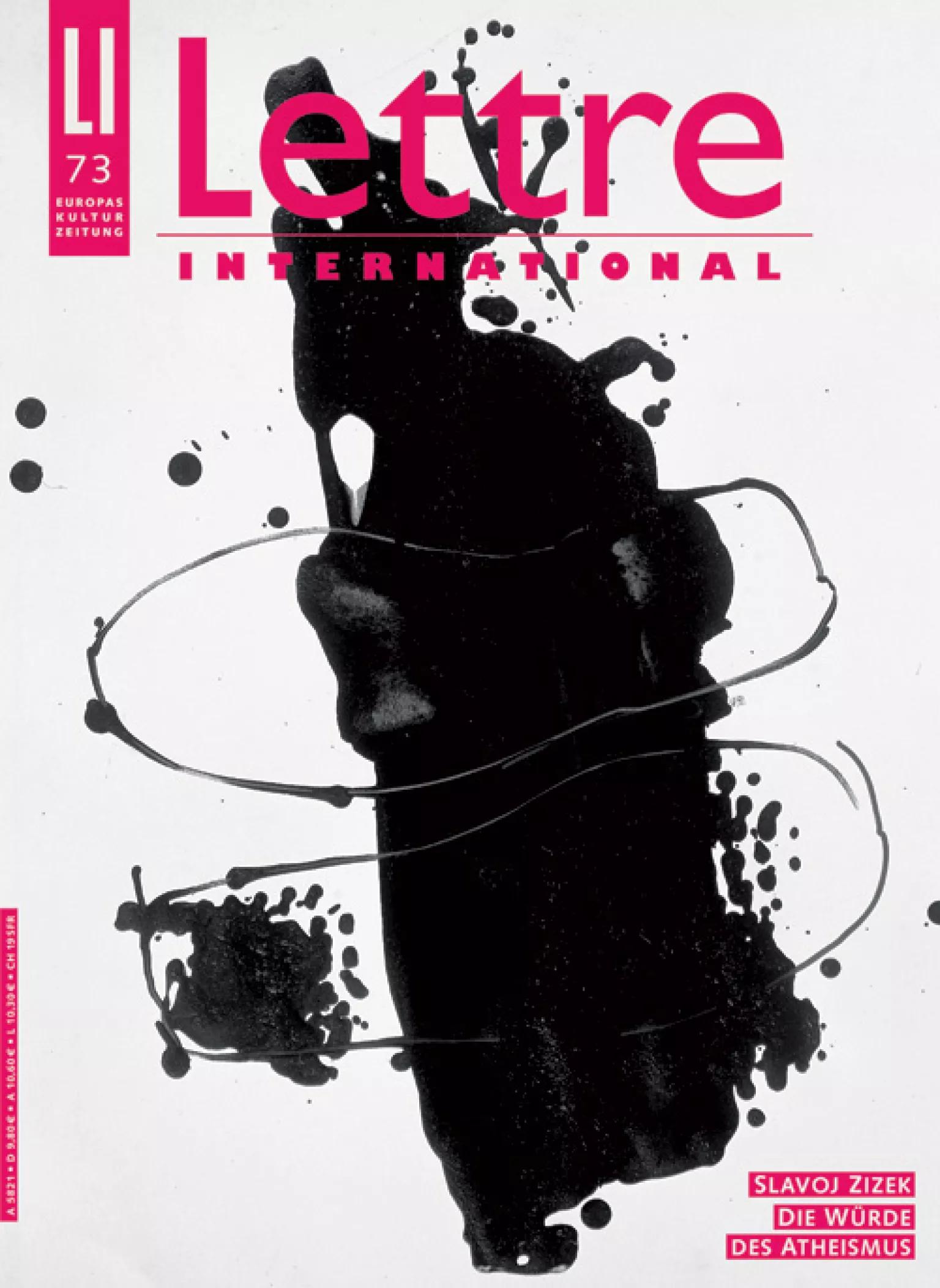LI 73, Sommer 2006
Kubanische Zeit
Radio dicke Lippe oder was mir in Havanna zu Ohren kamElementardaten
Genre: Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Spanischen von Ulrich Kunzmann
Textauszug
"Ich habe den Mund voller Nachrichten“, sagte Alejo Carpentier regelmäßig, wenn er nach langer Abwesenheit wieder in Havanna eintraf. Gern würde ich diesen Bericht mit dem gleichen Schwung beginnen, doch ich möchte klarstellen, daß ich aus Kuba mit dem Mund voller Fragezeichen zurückkehrte. Die Kubaner haben Beispiele und Gegenbeispiele zu bieten, als kultivierten sie so etwas in Treibhäusern. Ihre Vorliebe für Statistiken und Rekorde bringt sie dazu, auch wenn davon gar nicht die Rede ist, mitzuteilen, daß Sotomayor im Hochsprung weiter den Weltrekord von 2,45 Meter hält und daß Che eine Montecristo Nr. 4 rauchte. So ungesichert eine Information scheinen mag – die Zahlen verleihen ihr die harte Hülle unumstößlicher Beweiskraft. Gleichzeitig gibt es eine fest verwurzelte Kultur des Mißtrauens. Die Leute werden leise, sobald man in ihrer Wohnung „diesen Herrn“ erwähnt (der nur einer sein kann), und Telefongespräche wirken so hermetisch wie die Orakel des Santería-Kults. Die Kubaner haben keinen allgemeinen Zugang zum Internet, die meisten Nutzer verfügen lediglich über Intranet-Mail, sie können nicht online chatten oder im Netz surfen, und sie dürfen sicher sein, daß man ihre Meldungen mitlesen kann. In der regellosen kubanischen Alltagskost vermischen sich Mitteilungsdrang und Mißtrauen; man redet viel und verschweigt vieles. Der Reisende sieht sich gezwungen, einen Mittelwert aus den von ihm registrierten Erklärungen, Gegenerklärungen und dem Stillschweigen zu gewinnen. Wie soll man wissen, was richtig ist; wie die Tatsache von der Legende unterscheiden; wie erkennen, was sich noch nicht überprüfen läßt, sich aber später als Wahrheit erweist? Eine Woche lang hörte ich auf die Botschaften von Radio Dicke Lippe (Radio Bemba), also auf das, was von Mund zu Mund mit der unauslöschlichen Wirkung des Gerüchts weitergetragen wird. Im Unterschied zum Auslandskorrespondenten, der versteht oder verstehen will, was geschieht, schreibt der Reisechronist in einem perplexen Zustand, mit dem zwangsläufig anderen Blick des Uninformierten: Er steht im Schatten und sieht, was ans Licht kommt.
Ich habe die Namen der Personen und Orte verändert, mich jedoch bemüht, getreulich wiederzugeben, was ich hörte. Im Fall Kubas bedeutet das: Wenn das Leben nicht widersprüchlich scheint, so deshalb, weil es an sich schon kompliziert genug ist.
(...)
Das alltägliche Kuba widersetzt sich einer zusammenfassenden Schilderung. Es gibt wenigstens zwei Wirtschaftsformen: die Pesos, mit denen man schlechte Dienstleistungen zu lächerlichen Preisen bezahlen kann, und den in Dollars rechnenden Parallelmarkt. Wenn man die Klimaanlage die ganze Nacht anläßt, beläuft sich die Rechnung auf fünf Dollar im Monat – ein Vermögen, wenn man bedenkt, daß ein Kinobesuch 15 Dollarcents kostet und der monatliche Mindestlohn ungefähr drei Dollar beträgt. Beziehungsweise eine Lappalie für jemanden, der Geld aus dem Ausland oder von einem Touristen erhält.
In der fiktiven kubanischen Wirtschaft ist ein Trinkgeld immer größer als ein Lohn. Es kommt nicht selten vor, daß sich Ärzte bemühen, ihr Gehalt zu verdreifachen, indem sie nachts als Taxifahrer arbeiten. Es gibt nur sehr wenig, was der Besucher in Pesos bezahlen kann. Ich habe zehn Dollar eingetauscht und (als Pesos) fünf davon in einer Woche ausgegeben.
Viele arbeiten weiter aus Berufung – oder damit sie von zu Hause wegkommen. Andere nehmen ihre Arbeit erst gar nicht in Angriff, da sie zunehmend illusorisch scheint. Die Straßen sind zu jeder Zeit voll. Die Leute warten, daß die Stunden vergehen, als handle es sich um eine Parade.
1990 war ich zum erstenmal in Kuba, als die „Spezialperiode“ gerade begonnen hatte und der Fall der Berliner Mauer die Isolation ankündigte, der die Insel bald unterliegen sollte. „Wir sind allein geblieben“, sagte mir damals Eliseo Diego in seinem Haus in El Vedado. Unter asthmatischer Atemnot leidend, redete der Dichter über das zukünftige Schicksal wie über eine Zeit, in der alle Kubaner den gorrión, die unerklärliche Melancholie der Tropen, bekämen. Nach Kuba fuhr man damals als Mitglied von Solidaritätsdelegationen oder aus Arbeitsgründen. Tourismus war praktisch ausgeschlossen. Das ehemalige Hilton – in dem Batista vor seiner Flucht verlangte, ihm 18 Känguruhlederkoffer mit 12 Millionen Dollar in einer Reihe aufzustellen – wurde in das symbolträchtige Habana Libre umgewandelt. Dort quartierte sich der Stab des Comandante ein, als die Revolution siegte; dort logierten die Jurymitglieder des Preises Casa de las Américas, die zwei Monate in Havanna blieben. Heute fliegen schwarze Vögel über dem Wolkenkratzer. Sie haben das untrügliche Aussehen von Aasfressern. Die übrigen Hotels locken diese Tierart aus irgendeinem Grund nicht an. Welche „erlesene Leiche“ erwarten sie im Habana Libre? Obwohl ein spanisches Unternehmen dieses Hotel als Fünf-Sterne-Einrichtung ankündigt, zeigt es die Spuren der sich wandelnden Zeiten: Die Portiers verlangen fünfzig Dollar für die Genehmigung, daß man käufliche Schöne mit ins Zimmer hinaufnehmen darf; die elfte und zwölfte Etage sind in einem Dunkel versunken, das innerhalb des Gebäudes eine beunruhigende Schattenzone schafft; und die Gäste sind keine Freunde der Revolution mehr, sondern gierige Konsumenten, die zum Büfett stürmen, als kämen sie aus Landstrichen, in denen schlimmere Not als in Kuba wütet, und sie laden sich vier Eier mit sechs Würsten auf den Teller.
Jeder Reisende vergleicht das, was er sieht, mit seinem Herkunftsort. Den kubanischen Kellnern fehlt die Unterwürfigkeit ihrer mexikanischen Kollegen. („Einen doppelten Kognak mit Ihrem Kaffee, Chef? Wenn’s keinen gibt, besorge ich Ihnen welchen.“) Sie haben auch nicht den grollenden Blick, der mit einer solchen Katzbuckelei einhergeht. Die Kubaner sind apathisch und oft hochmütig, und sie verrichten Arbeiten weit unterhalb des Niveaus, das ihnen aufgrund ihrer Ausbildung eigentlich zustünde. Jeder von ihnen sieht gesünder als ein Durchschnittsmexikaner aus. Obwohl die Rationierungskarte in den Städten nur acht Eier monatlich und manchmal lediglich eines auf dem Land garantiert, findet man dort nicht jene Unpersonen, die auf den mexikanischen Straßen gleich jenen Häftlingen umherwanken, die in den Konzentrationslagern den Realitätssinn verloren hatten und von den Juden „Muselmänner“ genannt wurden. Die kubanische Armut erreicht nicht die Erniedrigung des Mexikaners, die unseres Muselmanns, der keine Schuhe besitzt und dessen Fingernägel Krallen gleichen. Ich vermute, daß einem Schweden oder Holländer ein solch relativierender Blick für die Mangelerscheinungen in Kuba fehlt.
Doch selbst wenn man die Ungerechtigkeiten, denen man in Mexiko begegnet, als Vergleichsmaßstab zugrunde legt, wirken die aus Kuba eintreffenden Nachrichten selten ermutigend. Am Allerseelentag besuchte ich den Friedhof Cristóbal Colón. Mit der landestypischen Leidenschaft, Rekorde zu brechen, erklärte man mir, dies sei der größte Friedhof Amerikas und der drittgrößte der Welt. Hier begrabe man 78 Prozent der Kubaner. „Das hier ist eine Nekropole, kein einfacher Friedhof“, sagte der Führer zu mir. Ich entfernte mich von ihm in ein anderes Viertel der Totenstadt. Dort unterhielt ich mich mit einem ungefähr achtzig Jahre alten Totengräber. Er sagte, es sei seine größte Freude, daß man jetzt sehr wenige junge Menschen beerdige. Das kann mit den bemerkenswerten Fortschritten im Gesundheitswesen zu tun haben, die von der Revolution erreicht wurden, doch es gestattet auch eine andere Deutung: Die Jungen verlassen die Insel, die Alten bleiben da. Die Bevölkerungsstruktur hat sich in letzter Zeit verändert. Vor einer Schultür sprach ich mit zwei Müttern, die auf ihre Töchter warteten. Sie erklärten, sie machten sich Sorgen, weil alle Schüler, wenn sie 14 würden, als „Stipendiaten“ weiterlernen müßten. Im Klartext: Sie müssen in ein Schülerwohnheim umziehen. Früher habe es die Möglichkeit gegeben, daß sie bei den Eltern wohnen blieben, aber für solche Schulen gebe es keine Lehrer mehr.
Alles, was in Havanna als Leistung bewundert werden kann, läßt sich auch als das Gegenteil davon betrachten. Ein begeisterter und hochherziger Anhänger der Revolution erzählte mir, Kuba habe Tausende armer Venezolaner an den Augen operiert: „Wenn sie das Augenlicht zurückgewinnen, bringt man sie an einen besonderen Ort, damit Himmel und Bäume das erste sind, was sie sehen. Manche erblicken ihre Kinder zum erstenmal. Es müßte mehr Propaganda über etwas so Anrührendes geben.“ Ich sprach mit Patienten des Krankenhauses für Augenheilkunde und bekam von der Schattenseite zu hören, die den üblichen Kontrast zu dem sonnenhellen Epos bildet, das ich kurz zuvor vernommen hatte. Kuba tauscht mit Venezuela Ärzte gegen Erdöl aus; man hat Mittellosen geholfen, dies aber auf Kosten der vernachlässigten Kubaner. Eine Frau erzählte mir, sie warte seit sechs Monaten auf eine Glaukombehandlung. „Und das, obwohl ich Beziehungen zum Ministerium habe – oder vielleicht gerade deshalb.“ Sie lächelte ironisch.
Kuba, die Insel der Paradoxe, verdankt sein Überleben weitgehend dem, was es anfangs ablehnte: den Geldüberweisungen aus dem Ausland sowie den Touristen, die nicht gerade auf der Suche nach dem ersten freien Land Lateinamerikas herkommen. Die Alternative „Vaterland oder Tod“ wirkt extravagant, wenn nichts so viel wert ist wie der Dollar. Seit dem 8. November 2005 gibt es konvertierbare Pesos. Ich sah Fidel bei dem Gespräch am runden Tisch, das zu diesem Thema im Fernsehen übertragen wurde. Seelenruhig auf das Offensichtliche verweisend, sagte er, Kuba werde eine Währung wie die aller Länder haben. Absolut wahr, gewiß – aber mußte man so lange warten, bis man über eine konvertierbare Währung verfügte?
Als in den neunziger Jahren der Dollar frei zirkulieren konnte, tauchten die jineteras auf: die lokale Variante der Prostitutierten. Von den vielen Meinungsäußerungen, die ich hierzu hörte, möchte ich diese wiedergeben: „Die jinetera läßt dich glauben, daß sie sich in dich verliebt. Sie träumt nicht davon, daß du sie bezahlst, sondern, daß du sie heiratest und von der Insel fortbringst.“ Um die von ihm angesprochene sentimentale Folklore zu veranschaulichen, erzählte mein Informant von einem sechsundsiebzigjährigen Herrn aus Jalisco, der seine havannischen Tage in den Armen einer Mulattin verbrachte. Am letzten Tag seines Aufenthalts war er zu sexuellem Verkehr unfähig. Die jinetera weinte an seiner Brust und stürzte ihn in einen überaus trostlosen Liebesschmerz. „Die Spezialität der jinetera ist die Fiktion der Liebe.“ Sex als Möglichkeit des Überlebens und der Flucht. Ein anderer teilte mir mit, daß im früheren Judenviertel, wo noch eine Synagoge in Gebrauch sei, das größte Kontingent der Jiddisch-Schülerinnen von jineteras gestellt werde, die nach New York auswandern wollten.
Die Kombination von Viagra und der kubanischen Krise hat den Sextourismus des Seniorenalters geschaffen. In den paladares genannten Privatrestaurants habe ich Schweizer Großväter in Begleitung junger Mädchen beobachtet, die aussahen, als wollten sie gleich Ricky Martins Die Jugend singen, und daneben Italiener, die sich sechs Jahrzehnte dem Glauben hingegeben hatten, daß pasta nicht dick mache: Sie befanden sich in der Gesellschaft von Mädchen, die wie für ein Casting des Produzenten Sergio Andrade gekleidet waren.
Die Libido wird von der Geopolitik beeinflußt, wie mir ein Bekannter verriet, der Stammgast in einem Bordell von Barcelona ist, wo man eine neunzehnjährige Polin für 150 Euro eintauscht: „Ist es meine Schuld, daß die Berliner Mauer gefallen ist?“ In Spanien stehen in den Zeitungen Anzeigen für Prostitution („Versaute und enthaarte Kleine macht mit bei unanständigen Trios“); man vereinbart sie per E-Mail, und sie findet an Orten statt, die mit klinischer Diskretion arbeiten; sie tragen den nicht sehr zurückhaltenden Namen puticlubes. („Hurenclubs“: Dieser Neologismus wird so häufig benutzt, daß sich der Dichter und Akademiker Ángel González vorgenommen hat, ihn ins Wörterbuch aufzunehmen.)
Unter verschiedenen Etiketten, aber unwiderstehlich schwungvoll floriert der älteste Beruf der Welt auf der ganzen Erde. In Kuba tritt er offensichtlicher in Erscheinung, weil die Kontaktaufnahme auf der Straße stattfindet. „Nichts hilft soviel wie ein toller Wagen dabei, Tussis aufzureißen: Das ist ein Supermagnet“, vertraute mir ein mexikanischer Sextourist an. Was jedoch die kubanische Prostitution tatsächlich auszeichnet: daß sie während der „Spezialperiode“ aus der übermächtigsten Not entstand, als die „Steaks“ in Schweineschmalz gebratene Pampelmusenschalen waren.
Die Jahre 1993 bis 1996 brachten die Küche ohne Zutaten oder die „Als-ob“-Küche. Die zwanghafte und erstaunliche Vorliebe der Insulaner für das Essen des Festlandes (der köstlichste Fisch ist der, der nach Fleisch schmeckt) verleitete dazu, sogar Haushaltsutensilien als Fleisch zu tarnen. Es wird erzählt, daß von den Molen Havannas ein Container verschwand, der Küchenlappen enthielt. Ein findiger Kopf, dessen Einfälle sich eigentlich nicht allzusehr von Ferran Adriàs experimenteller Küche unterschieden, tauchte die Feudel so lange in Zitronensaft, bis sie ihre ursprüngliche Festigkeit verloren; danach panierte er sie mit dem Feingefühl eines Pianisten und verkaufte sie als Sandwichs mit „Mailänder Schnitzeln“.
(...)