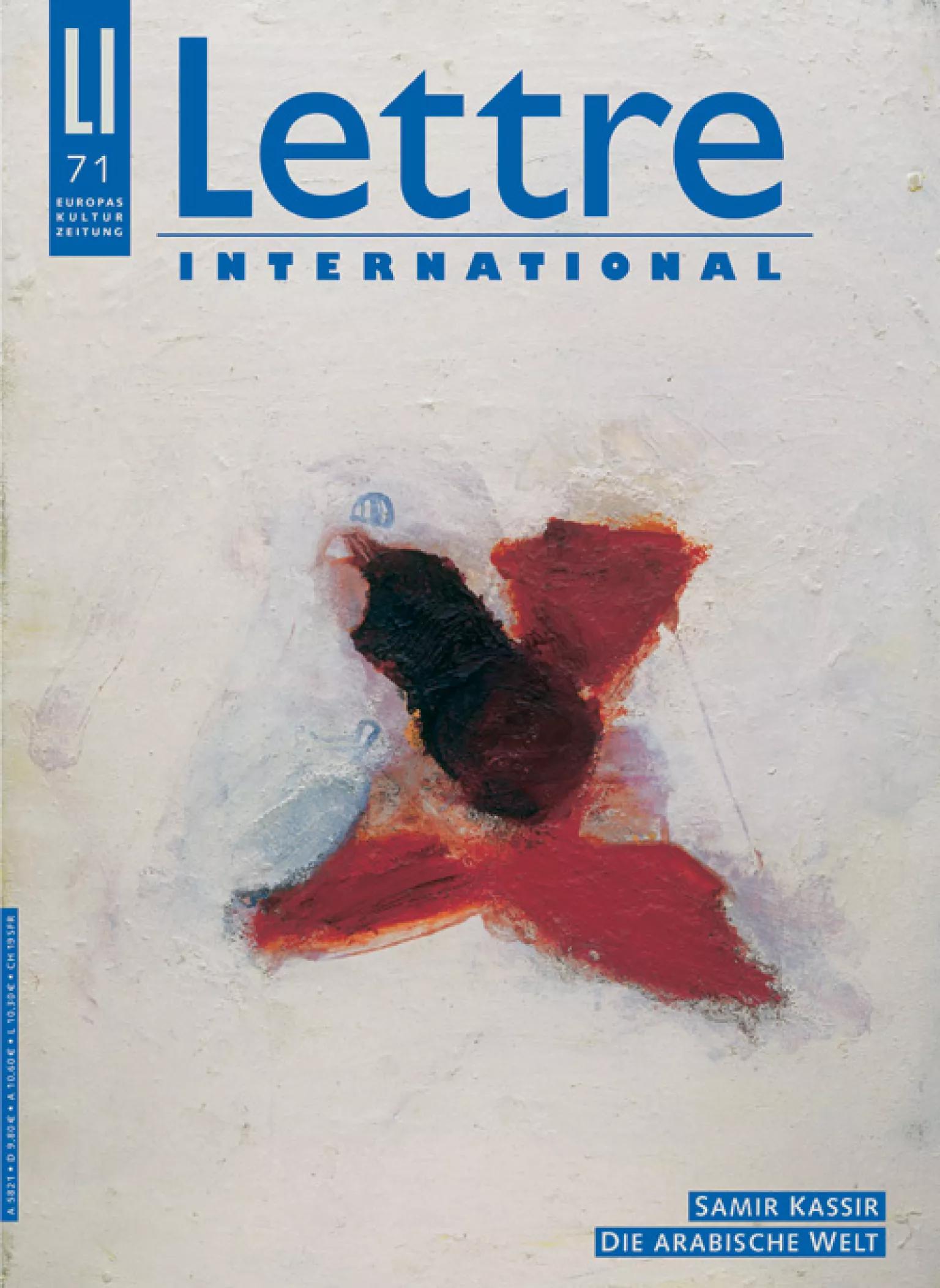LI 71, Winter 2005
Walküren über dem Irak
Militärpornographie - oder Versuche, einen Antikriegsfilm zu drehenElementardaten
Genre: Reportage
Übersetzung: Aus dem Englischen von Eike Schönfeld
Textauszug
Anfang 2003, etwas über zehn Jahre nach dem Ende des ersten Golfkrieges – also des kurzen, schnellen, sauberen, klaren und ach so schmerzlosen und moralisch überlegenen –, und schon auf der Schwelle dessen, was rasch der unausweichlich erscheinende Beginn seiner weit komplizierteren Fortsetzung werden sollte, veröffentlichte Anthony Swofford, ein ehemaliger Marine-Scharfschütze in jenem ersten Konflikt, den mitreißenden, düsteren Bericht seiner Erlebnisse auf dem kuwaitischen Kriegsschauplatz Anfang der neunziger Jahre – eine bittere Anklage, bar aller Illusionen oder billiger Tröstungen. Von allen Enthüllungen in Swoffords lebhafter Chronik stand eine der aufwühlendsten gleich am Anfang des Buchs. Er beschreibt, wie Marines, kurz bevor sie in die Schlacht geschickt werden, sich in einen ekstatischen Bereitschaftszustand puschten, indem sie sich Videos über frühere Kriege ansahen, insbesondere Kampfszenen aus einigen der härtesten Vietnamfilme – Filmen, denen wirklich jede Illusion, jeder Trost genommen war –, beispielsweise Robert Duvalls berühmten und blutigen Hubschrauberangriff mit dem „Walkürenritt“ als Begleitmusik in Francis Ford Coppolas Apocalypse Now.
„Es heißt“, schreibt Swofford, „viele Vietnamfilme seien gegen den Krieg, ihre Botschaft sei, Krieg sei inhuman. (…) Eigentlich aber sind alle Vietnamfilme für den Krieg, ungeachtet ihrer vermeintlichen Botschaft und dessen, was Kubrick, Coppola oder Stone beabsichtigten.“ Swofford räumt ein, daß Mr. und Mrs. Johnson in Omaha, San Francisco oder Manhattan bei solchen Filmen „weinen und ein für allemal beschließen, daß Krieg unmenschlich und schrecklich ist, und es ihren Freunden in der Kirche und ihrer Familie sagen, doch Corporal Johnson in Camp Pendleton und Sergeant Johnson in der Travis Air Force Base … und Lance Corporal Swofford in der Twentynine Palms Marine Corps Base werden durch genau dieselben Filme erregt, weil ihre magische Brutalität die schreckliche und verabscheuungswürdige Schönheit ihrer Kampftechniken zelebriert“, fährt Swofford schonungslos fort. „Filmische Bilder von Tod und Gemetzel sind für den Soldaten Pornographie; mit solchen Filmen streichelt man seinen Schwanz, krault ihm mit der rosa Feder der Geschichte die Eier, bereitet ihn auf seinen echten Ersten Fick vor. Es spielt keine Rolle, wie viele Mr. und Mrs. Johnson gegen den Krieg sind … die tatsächlichen Killer, die mit ihren Waffen umzugehen wissen, sind es nicht.“
„Die angeblichen Antikriegsfilme sind gescheitert“, schließt Swofford einige Absätze weiter, und charakterisiert seine Euphorie an jenem fernen Nachmittag. „Als junger Mann, der mit Vietnamfilmen groß geworden ist, will ich Munition und Alkohol und Dope, ich will ein paar Huren vögeln und irakische Arschlöcher killen.“
Man sollte meinen, daß eine solch unverblümte Würdigung eine neue Generation von Filmleuten ins Grübeln bringt: ob der Versuch, einen Bericht wie den Swoffords zu verfilmen, vielleicht doch keine so gute Idee ist, zumal gerade ein neuer Krieg mit einem frischen Kader junger Männer und Frauen tobt, die ebenfalls für die Schlacht gepuscht werden; ob das emotional so unmittelbare (mediumlose) Ausdrucksmittel Film einfach nicht in der Lage ist, solche abgewogenen und vorsichtigen Überlegungen umzusetzen.
Und dennoch – zum Teufel mit solchen moralischen Warnungen – hat sich ein neues Team von Filmemachern genau dieser Herausforderung angenommen. Als der seinerzeit noch drohende Krieg richtig ausbrach, beauftragten die Produzenten Douglas Wick (Gladiator) und Lucy Fisher den Drehbuchautor – und Vietnam-Veteranen – Bill Broyles Jr. (Apollo 13, Cast Away) sowie den englischen Bühnenregisseur Sam Mendes (American Beauty und Road to Perdition und so weiter), Swoffords zutiefst bedrückende Vision auf die Leinwand zu übertragen. Nun, da die Filmarbeiten abgeschlossen sind und man schon mitten in der Nachproduktion ist (der Film kommt am 5. Januar in die deutschen Kinos), hat das Team beschlossen, die Herausforderung frontal anzunehmen und die Szene, in der sich junge Marines kurz vor ihrem Kampfeinsatz in eine lustvolle Raserei versetzen, indem sie sich jenen Walkürenangriff ansehen, gleich an den Anfang des Films zu setzen – gewissermaßen als Dreh- und Angelpunkt ihres Werks.
Das Ergebnis ist eine der berührendsten und verstörendsten Szenen der jüngeren Filmgeschichte, in nicht geringem Maße auch dank der aufwendigen Arbeit des Cutters, des legendären Walter Murch (The Conversation, die Der-Pate-Filme, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Der englische Patient), der sich mit der aufreibenden Aufgabe abquälen mußte, eine Szene, an der er nahezu dreißig Jahre zuvor als entscheidendes Mitglied des damaligen Apocalypse-Now-Teams monatelang gesessen hatte, immer wieder neu zu bearbeiten, dieses Mal jedoch in einem völlig neuen und noch verstörenderen Licht.
„Manchmal habe ich das Gefühl, in meiner eigenen Escher-Zeichnung zu sein“, räumte Murch mir gegenüber eines Abends ein. Eine Hand zeichnet die jeweils andere sozusagen ins Leben: Seine damaligen Entscheidungen prägten seine jetzigen und umgekehrt.
Ich hatte für Murchs Notlage ein gewisses Verständnis. Schließlich schrieb ich für eine Zeitschrift, die in der Vorbereitungsphase des gegenwärtigen Krieg selbst einen Auszug aus Swoffords Buch gebracht hatte in der Hoffnung, er könne dazu beitragen, die Leute zur Vernunft zu bringen (ein Unterfangen, das sich ebenfalls nicht als allzu wirkungsvoll erwiesen hatte). Jedenfalls schaute ich immer wieder bei Murch in den Nachproduktionsstudios im Manhattaner West Village vorbei (passenderweise auf halbem Weg zwischen seiner eigentlichen Wirkungsstätte in Nordkalifornien und Mendes’ Wohnsitz in London). Groß, schmal, gebeugt, nicht aus der Ruhe zu bringen (wie Zen-zentriert) saß Murch vor seinem computerisierten Schneidetisch und scrollte durch die Originalsequenz aus Apocalypse Now, die auf einen kleinen Monitor darüber gelegt war, dann durch Mendes’ reiche Fundgrube von Gegenschüssen, die auf einem anderen Monitor liefen, und verschachtelte die beiden für die spätere Projektion akribisch auf dem größeren Plasmabildschirm an der Seite.
Die Originalszene: Duvall in der Rolle Colonel Bill Kilgores, des Lieblings der Ersten Luftkavallerie, ungeheuer flott, draufgängerisch, forsch, ohne jedes Interesse an seinem neuen Auftrag (das Schnellboot mit Willard, gespielt von Martin Sheen, zu der vietcong-verseuchten Mündung des Flusses zu bringen, den dieser dann im Zuge seiner conradesken Mission hinauffahren mußte) – oder vielmehr so lange ohne jedes Interesse, bis er erfährt, daß sich in Sheens Trupp ein junger, ausgeflippter Navy-Mann befindet, der zufällig ein südkalifornischer Supersurfer ist, und der fragliche Deltastrand auch noch die besten Wellen der ganzen vietnamesischen Küste zu bieten hat. Kilgore ist ein echter Aficionado, und als einer seiner jüngeren Offiziere Bedenken gegen einen Angriff auf eine gut verteidigte Vietcong-Festung äußert, kommt eine denkwürdige Reaktion: Warum sie sich um irgendwelche Vietcong-Verteidiger kümmern sollten? „Charlie surft nicht.“ Am nächsten Morgen, seine Heli-Flotte ist schon startbereit, läßt Kilgore einen seiner Jungs das traditionelle Trompetensignal schmettern, wie man es aus jedem Kavalleriewestern kennt. Die Helikopter ziehen los, und wenige Meilen vor dem Dorf befiehlt Kilgore einem anderen seiner Männer, die Lautsprecher für die psychologische Kriegsführung anzuwerfen, aus denen Wagners „Walkürenritt“ erschallen wird. „Dabei scheißen sich die Schlitzaugen in die Hosen“, brüllt Kilgore zur Erklärung seinem neuen Surferkumpel zu. „Meine Jungs sind begeistert.“
(…)