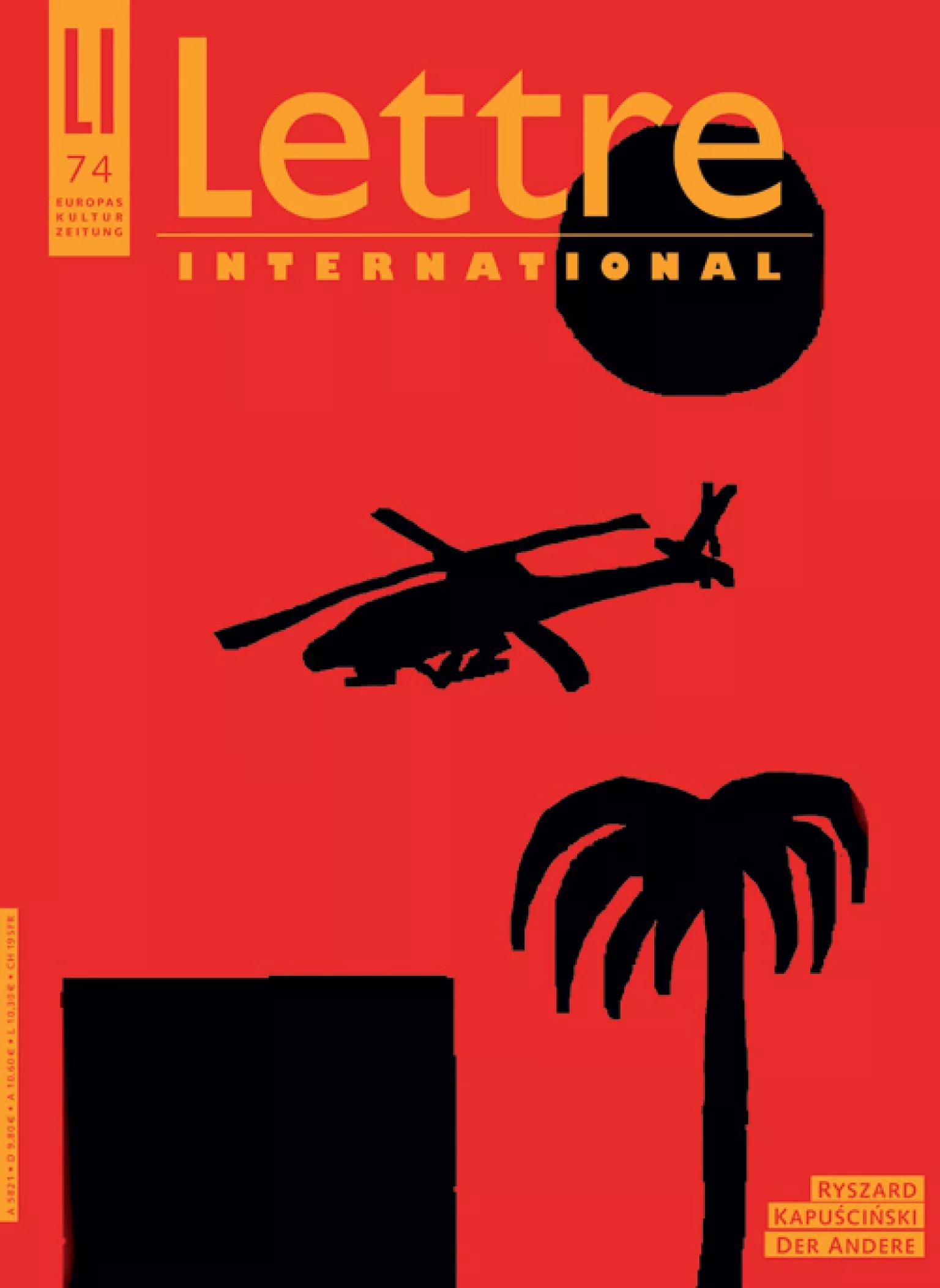LI 74, Herbst 2006
Leckerei kalte Haut
Ein Volk vergiftet sich selbst - Nahrungsmittelsicherheit in ChinaElementardaten
Genre: Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Chinesischen von Hans Peter Hoffmann
Textauszug
Was Essen und Trinken angeht, so besteht der größte Unterschied zwischen dem Westen und China womöglich in den „Leckerbissen" hier und dem „Hauptgericht" dort. Die westliche Gastronomie besteht in richtigen Restaurants vornehmlich aus dem „Hauptgericht", in Schnellrestaurants aus großen Standardportionen, während China eine jahrtausendealte Tradition von „Leckerbissen" hat. Aus diesem Prozeß der Tradierung erwuchs eine kulturelle Identifikation, weit bedeutsamer ist aber, daß sich daraus in der Agrargesellschaft ein lebhafter Handel von hoher Zuverlässigkeit entwickelt hat. Menschen, deren Beruf die Landwirtschaft war, machten sich zu Ernte- und Festzeiten leckere Häppchen zurecht, um sie allein oder gemeinsam mit Freunden und Verwandten zu genießen; mit dem, was übrig war, wurde in den Nachbardörfern gehandelt - die Güte des Essens war in der Regel ein Symbol für die Kunstfertigkeit der Ehefrau und für das äußere Ansehen der Familie. Zu einem vollendeten Essen gehörte auch die Qualität der Zutaten, was sich mit der Zeit in der jeweiligen Gegend herumsprach - und so gab es eine Menge wohlschmeckender Leckerbissen von ausgesuchter Qualität, die man ohne Bedenken genießen konnte.
(...)
Das Gefühl, auf die kleinen berühmten Leckerbissen und überhaupt auf das, was man ißt, vertrauen und mit solchen besonderen Leckereien sein Image aufpolieren zu können, hat mehr zu bedeuten als das eigentliche „Essen". Aber heute machen diese Häppchen, die es nun schon seit hundert Generationen gibt, den Leuten Angst.
Nehmen wir die Mixpickles als Beispiel. Sie sind eine regionale Delikatesse, von der die Menschen in Sichuan ihren Stolz herleiten. Man muß nur ein bißchen vor die Tür gekommen sein, da wird man fast niemanden finden, der diese zudem noch preiswerte Köstlichkeit noch nicht probiert hat. Doch wenn man jetzt nach Sichuan kommt, kann es geschehen, daß Freunde dich warnen: Ißt du etwa Mixpickles?
Ein Teil der Firmen in Chengdu kocht die Mixpickles mit DDVP (Dichlorvos) ein. Früher verging in keiner Familie Sichuans ein Tag ohne Mixpickles, aber heute sagen selbst Chefs solcher Fabriken: „Wir essen die Mixpickles, die wir produzieren, eigentlich nicht mehr, die geben wir nur Leuten von außerhalb."
In einem heimlichen Interview packte jemand aus: „Das wichtigste bei der Herstellung von Mixpickles ist das Einlegen des Kohls. Mir fiel auf, daß das Salz, mit dem die Mixpickles eingesalzen wurden, nicht nur weißer war als normales Salz, auch waren die Salzkörner feiner. Also fragte ich: ,Wieso ist das Salz so weiß?' Der Direktor antwortete: ,Das ist Schmuggelware, die ist pro Tonne fünfzig Yuan billiger.' Später habe ich im Hof der Fabrik die Salzsäcke liegen sehen, sie trugen als Aufschriften ,Industriesalz' und ,Nicht zum Verzehr geeignet'.
Arbeiter brachten mich in einen weiteren Hof, in dem das Industriesalz sich in ordentlichen Haufen türmte. Ich fragte: ,Benutzt ihr dieses Salz immer?' Ein Arbeiter antwortete: ,Ja.' ,In anderen Fabriken auch?' Der Arbeiter nickte.
Ein paar Tage später besuchte ich die gleiche Fabrik noch einmal, und mir fiel auf, daß am Rand der Mixpickles-Becken sehr viele Insekten waren. Ich fragte nach dem Grund dafür. Der Direktor gab mir zur Antwort: ,Beim Einsalzen kommen die Insekten, dann tun wir ein Insektizid rein, davon verschwinden sie.' Ein Arbeiter begann ein Insektizid über die Becken zu sprühen. Ich fragte, was das für ein Mittel sei? Der Arbeiter antwortete: ,Speziell gegen Insekten.' Dann fügte er hinzu, um die Insekten loszuwerden, müsse man die Mixpickles, bevor sie die Fabrik verließen, im Abstand von ein paar Tagen immer wieder spritzen. Und was war das für ein Mittel? Arbeiter und Direktor sagten, sie wüßten es nicht. Da sich auf den Flaschen, in denen das Mittel war, kein Etikett fand, füllte ich ein wenig von der roten Flüssigkeit in eine Plastikflasche, versiegelte sie und schickte sie zur Untersuchung an das chinesische Nahrungskontrollzentrum für die Ein- und Ausfuhr von Lebensmitteln. Das Untersuchungsergebnis zeigte: Das Mittel bestand zu 99 Prozent aus DDVP ...
Darüber hinaus fand ich heraus, daß ein Drittel der bei Stichproben untersuchten Mixpickles nicht den Bestimmungen des Qualitätsüberwachungsbüros von Chengdu entsprach: Am 16. Juni 2004 veröffentlichte das Büro einen Bericht über stichprobenartige Untersuchungen. Die Überschreitung der Grenzwerte für Nahrungsmittelzusätze war relativ schwerwiegend. Es wurden siebzig Produkte von 56 Firmen untersucht, innerhalb der staatlich festgelegten Grenzen lagen nur 16 von ihnen, das sind nur 23 Prozent; 17 Produkte überschritten die Grenzwerte. Bei der Stichprobe wurde festgestellt, daß das Nettogewicht von neun Produkten und die Etikettierung von 48 Produkten nicht den Vorschriften entsprachen. Zur Zeit verlangt das Qualitätssicherungsbüro von den negativ geprüften Produktionseinheiten eine Korrektur ihrer Fehler."
„Drei Tage ohne Sauer, und die Beine werden flauer" - das ist der Slogan der für ihre saure Fischsuppe berühmten Restaurants in Guizhou. Doch in letzter Zeit sind einige von ihnen in Verruf geraten; am 16. Juni 2006 wurden 215 Betriebe von den zuständigen Stellen bis auf weiteres geschlossen, weil sie in die eigentliche Suppe, in die Würze und dergleichen Lebensmittel Opiate in verschiedenen Mengen untergemischt hatten. Nach einer Erklärung von Zhang Xing, dem stellvertretenden Leiter des Antidrogenteams der Polizei von Guizhou hat sein Team gemeinsam mit dem Krankheitskontrollzentrum und dem Lebens- und Arzneimittelkontrollbüro eine spezielle Offensive gegen den Mißbrauch von Opiaten in Restaurationsbetrieben gestartet. Dabei sind 3 200 Gramm Mohnsamen und 1 700 Gramm Mohnkapseln beschlagnahmt worden, und die zuständigen Stellen haben bei den 215 schweren Fällen eine vorläufige Schließung der Betriebe veranlaßt. Bei 36 eher leichten Fällen wurde eine warnende Belehrung erteilt.
Es heißt, viele auf Rind- und Lammfleisch spezialisierte Restaurants, Frühstücksläden und Restaurantbetriebe für Lamm, Hund, scharfe Suppen usw. hätten aus Profitgier und um Gäste zum Wiederkommen zu animieren illegal Opiate untergemischt. Wei Tao, der stellvertretende Leiter des Gesundheitskontrollzentrums der Provinz Guizhou, Abteilung Lebensmittelprodukte, gab bekannt, daß die Suppen verschieden hohe Dosen von Morphium beinhalteten, ein Teil davon sogar in relativ hoher Konzentration. Er sagte, wenn Gäste über einen langen Zeitraum solche Nahrungsmittel zu sich nähmen, könnten sie süchtig und abhängig werden; in schlimmen Fällen könne das zu direktem Drogenkonsum führen.
Außerdem kam in der letzten Zeit, ebenfalls in Guizhou, bei stichprobenartigen Untersuchungen der youtiao, der beliebten salzigen Ölgebäckstangen, durch Gesundheitsbehörden heraus: Dreißig untersuchte youtiao-Stände und Gastronomiebetriebe überschritten mit ihren Produkten ausnahmslos die staatlich festgesetzte Höchstgrenze an Aluminium, in einem Fall um das Elffache. Der Grund dafür ist, daß in vielen Betrieben das Wissen um die Lebensmittelsicherheit fehlt, weswegen bei der Produktion übermäßig viel Alaunstein zugegeben wird.
Wie mir ein älterer Restaurantzulieferer offenbarte, gibt es zur Zeit das Problem, daß in Fischrestaurants das Öl immer wieder verwendet wird. Es ist an der Tagesordnung, die ölige Sauce, die auf den Tischen übrigbleibt, über ein Sieb in rostfreie Stahlbehälter zu gießen und am Abend das scharfe Öl vom Wasser zu trennen. Um solches Öl wiederverwenden zu können, müsse man bei der Zubereitung der Fische große Mengen von Chilipaste und anderer Würze zugeben, um zu kaschieren, daß das Öl nicht mehr frisch ist. So ist aus dem „in Öl fritierten Fisch" ein „in Speichel fritierter Fisch" geworden.
Die „kalte Haut" ist eine berühmte Leckerei des Distrikts Guanzhong in der Provinz Shanxi, die von alters her gerühmt wird und vor allem bei Frauen beliebt ist. Durch die erfolgreichen Auftritte verschiedener Komiker aus Shanxi eröffnete sich für diese Leckerei ein landesweiter Markt. Angesichts der üblen Vorkommnisse glaube ich, hat sich einigen, die diese Leckerei erfunden haben, der Magen umgedreht: Es war in Peking, in einem Laden, in dem man die „kalte Haut" schwarz herstellte, wo sie den Teig mit den Füßen kneteten und in den fertigen Teig auch noch Urin und Spucke unterrührten.
Doch am 18. Juni 2004 enthüllte ein siebzehnjähriger Arbeiter in den Medien, wie bei der Schwarzfabrikation von „kalter Haut" im Pekinger Chaoyang-Distrikt vorgegangen wurde. Der junge Arbeiter erzählte, daß sie den Teig geknetet hätten, wie man bei der Wäsche große Kleidungsstücke walkt; und wenn sie müde wurden, seien sie mit den Füßen in die Teigbottiche gesprungen und hätten den Teig mit den Füßen geknetet; wenn ein Stück Teig auf den Boden gefallen und schmutzig geworden sei, sei es wieder in den Bottich zurückgeworfen worden; auch habe man das Werkzeug nach Feierabend nie saubergemacht. Sie hätten sich auch nicht die Hände gewaschen, wenn sie vom Klo kamen, und als der Chef das bemerkte, habe er nur gelacht und gesagt: „Laßt das nur keinen sehen!" Nachdem der Chef sie drei-, viermal beschimpft und ihnen Lohn abgezogen habe, seien zwei, drei von den Arbeitern sauer gewesen und hätten in den Teig gepinkelt, und zwei-, dreimal habe er gesehen, wie jemand voller Wut in den großen Topf mit der gerade kochenden „kalten Haut" gespuckt habe. Mit ihm, so erzählte der junge Mann weiter, hätten noch ein gutes Dutzend Kinder dort gearbeitet, die der Chef alle aus Shanxi angeworben habe. Das jüngste sei erst 14 gewesen, keines habe ein Gesundheitszeugnis gehabt, viele von ihnen nicht einmal einen Ausweis.
Auch was am gleichen Tag über Tofu herauskam, war nicht dazu angetan, optimistisch zu stimmen. Seit dem 1. Juli 2003 war in Peking der Handel mit Tofu systematisiert und ein Verbot für „nackten" Tofu ausgesprochen worden. Doch auf ein paar Bauernmärkten in den Vorstädten wurde weiterhin „nackter", das heißt unverpackter, Tofu ver-kauft, der den hygienischen Anforderungen nicht entsprach. Gegenwärtig führen die Verkaufskanäle des „nackten" Tofu über Bauernmärkte bis in die Kantinen und Küchen von Pensionen, Hotels, Behörden und Schulen. Dieser Tofu ist billig, und die Lockerung der Kontrollen hat dazu geführt, daß die Märkte für „nackten" Tofu wieder fröhliche Urständ feiern. Gegenwärtig taucht auf den Bauernmärkten vermehrt Tofu aus kleinen Fabriken oder aus schwarzer Herstellung auf, nur daß der Handel stärker im verborgenen stattfindet. Dieser schwarze Tofu wird oft schon verschoben, bevor die Gesetzeshüter morgens ihren Dienst antreten, oder er wird direkt an die Haustür geliefert.
Wie mir der Verantwortliche eines Tofu-Unternehmens offenbarte, verfolgte man eines Tages eine Bande Schwarzhändler bis zum Markt an der Achtmeilenbrücke um festzustellen, daß die normale Lieferzeit von fünf Uhr auf zwei oder drei Uhr in der Frühe vorverlegt worden war. Nach dem Bericht eines anderen Mitwissers investieren solche kleinen Tofu-Fabriken, wenn es hoch kommt, 2 000 Yuan; sie besäßen nichts als eine elektrische Mühle, einen verrotteten Benzinkanister und Gummischläuche.
Zunächst werden Sojabohnen verschiedenster Qualitäten in Stoffsäcke gefüllt, danach werden die unverlesenen Sojabohnen samt Säcken im Wasser eingeweicht, das Ganze wird direkt zermahlen, schließlich für ein paar Stunden auf einer Art Rost trockengepreßt - und fertig ist der Tofu. Jener Eingeweihte sagte, so ein Tofu habe einen Proteingehalt von etwa vier Prozent, bei Tofu aus der regulären Produktion beliefe er sich aber auf siebzig bis achtzig Prozent: „Man kann ohne Übertreibung behaupten, daß der Verkauf dieses Tofu dem Verkauf von Wasser gleichkommt."
Tofu ist eine Delikatesse, die über Tausende von Jahren von unseren Vorfahren an uns weitergegeben worden ist, und ich habe mir sagen lassen, daß einige unserer Landsleute, die im Ausland leben, versuchen, Tofu als das gesunde Nahrungsmittel des 21. Jahrhunderts zu verbreiten, wobei sie in einigen Ländern auch erste Erfolge ernten. Welche Auswirkungen werden diese Zustände bei uns auf die Entwicklung der internationalen Märkte wohl haben?
Wir sind eigenhändig dabei, Delikatessen und berühmte Spezialitäten mit einer jahrtausendealten Tradition zu verderben: von Guanshengyuan-Mondkuchen mit vergammelter Füllung bis hin zu dem DDVP-Schinken aus Jinhua, von tückischem Dörrfleisch aus Taiqiang bis zum kranken Rindfleisch aus Pingyao, vom Schweinefleisch voller „Magerfleischpulver" bis zu giftigen Sojasprossen - ununterbrochen kommen uns derartige Nachrichten zu Ohren.
(...)