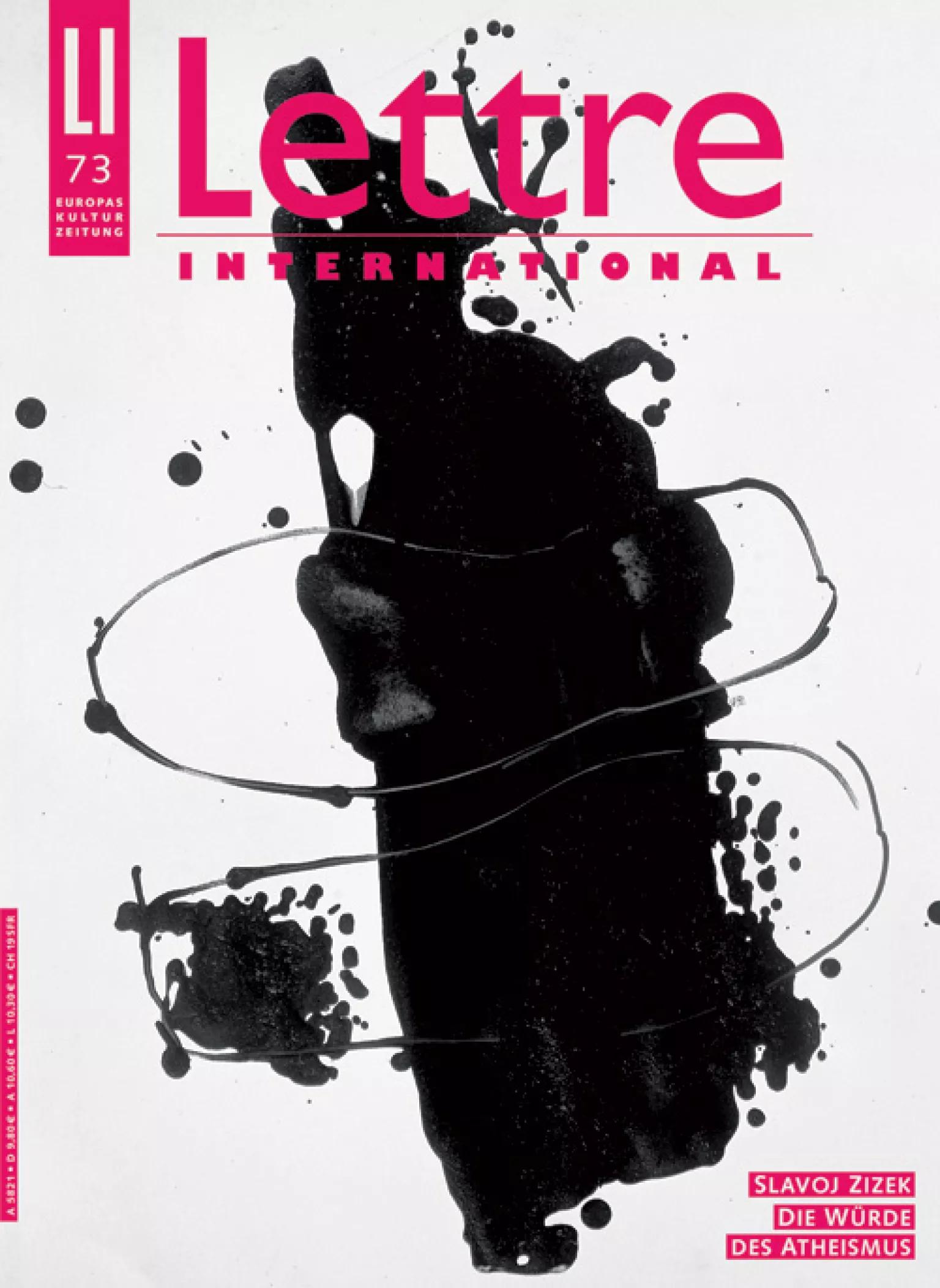LI 73, Sommer 2006
Bluttrübe Zeiten
Die Antinomien der toleranten Vernunft und die Würde des AtheismusElementardaten
Textauszug
Die Aufregung und das Gefühl der Dringlichkeit, die durch die täglichen Berichte über gewaltsame Demonstrationen gegen die Urheber der Mohammed-Karikaturen hervorgerufen wurden, sind am Schwinden, und es ist an der Zeit, zurückzublicken (und in die Zukunft zu schauen), um Bilanz zu ziehen.
Es liegt eine unverkennbare Ironie darin, daß 99,99 Prozent der Abertausende, die sich beleidigt fühlten und demonstrierten, die dänischen Karikaturen überhaupt nicht gesehen haben. Dies konfrontiert uns mit einem weniger attraktiven Aspekt der Globalisierung: Das „globale Informationsdorf“ ist die Voraussetzung dafür, daß etwas, das in einer obskuren Tageszeitung in Dänemark stattfand, derart gewaltsame Reaktionen in weit entfernten muslimischen Ländern ausgelöst hat. Man hätte meinen können, Dänemark und Syrien (und Pakistan und Ägypten und der Irak und der Libanon und Indonesien und …) seien Nachbarländer. Diesen Sachverhalt verkennen diejenigen, welche die Globalisierung lediglich als eine Chance begreifen, die ganze Welt zu einem einheitlichen Kommunikationsraum werden zu lassen, der die Menschheit zusammenführt. Da ein Nachbar, wie Freud schon vor langer Zeit vermutete, primär ein Ding ist, ein traumatischer Eindringling, jemand, dessen andersartige Lebensweise (oder vielmehr Art der jouissance, die in seinen sozialen Praktiken und Ritualen zum Ausdruck kommt) uns stört, unsere gewohnte Lebensweise durcheinanderbringt, kann allzu große Nähe des Nachbarn auch zu aggressiven Reaktionen führen, weil man den verstörenden Eindringling loswerden will. Um mit Peter Sloterdijk zu sprechen: Mehr Kommunikation bedeutet zunächst vor allem mehr Konflikte.
Deshalb muß die Haltung des „Einander-Verstehens“ um die Haltung des „Einander-aus-dem-Weg-Gehens“ ergänzt werden, um die Wahrung eines angemessenen Abstands, um einen neuen „Code der Diskretion“. Was Kritiker gewöhnlich als Schwäche und Versagen der europäischen Zivilisation denunzieren, nämlich die „Entfremdung des sozialen Lebens“, macht es eben dieser europäischen Zivilisation leichter, unterschiedliche Lebensweisen zu tolerieren. Entfremdung bedeutet (auch), daß die Distanz dem gesellschaftlichen Gefüge selbst eingeschrieben ist. Auch wenn ich in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen Menschen lebe, nehme ich sie normalerweise nicht zur Kenntnis. Es ist mir erlaubt, den anderen nicht zu nahe zu kommen; ich bewege mich in einem sozialen Raum, in dem ich mit anderen unter Einhaltung bestimmter äußerer „mechanischer“ Regeln interagiere, ohne ihre „Innenwelt“ zu teilen. Vielleicht besteht die Lehre, die es hieraus zu ziehen gilt, gerade darin, daß ein gewisses Maß an Entfremdung für die friedliche Koexistenz von Lebensweisen unverzichtbar ist. Manchmal ist Entfremdung nicht das Problem, sondern die Lösung. Die Globalisierung wird nicht dann explosiv, wenn wir voneinander isoliert bleiben, sondern wenn wir einander zu nahe kommen.
Aber wurden diese gewaltsamen Reaktionen wirklich durch die kulturelle Kluft zwischen dem säkularen Westen und den muslimischen Ländern ausgelöst, also durch die Tatsache, daß islamische Fundamentalisten einen spielerisch-ironischen Umgang mit Gott unerträglich finden? Einem westlichen Liberalen kommt beim Anblick einer gewalttätigen Menge die erste Zeile von William Butler Yeats’ (im Titel zitierten Gedicht) Das Zweite Kommen in den Sinn. Dort heißt es weiter: „Die Besten zweifeln bloß, derweil das Pack / Voll leidenschaftlichem Erleben ist.“ Ist dies nicht eine gute Beschreibung der heutigen Spaltung zwischen anämischen Liberalen und leidenschaftlichen Fundamentalisten? „Die Besten“ sind nicht mehr in der Lage, sich vorbehaltlos für etwas einzusetzen, während „das Pack“ sich für (rassistischen, religiösen, sexistischen) Fanatismus einsetzt.
Doch sind die terroristischen Fundamentalisten, ob christliche oder muslimische, wirklich Fundamentalisten? Ein Merkmal kennzeichnet alle wahren Fundamentalisten, von tibetanischen Buddhisten bis zu den Amischen in Nordamerika, nämlich der Mangel an Ressentiment und Neid, ihre tiefe Gleichgültigkeit gegenüber der Lebensweise der Ungläubigen. Warum sollten sie sich von Ungläubigen bedroht fühlen, warum sollten sie sie beneiden, da wahre Fundamentalisten doch der Überzeugung sind, sie hätten ihren Weg zur Wahrheit gefunden? Wenn ein Buddhist einem westlichen Hedonisten begegnet, verurteilt er ihn keineswegs, sondern stellt wohlmeinend fest, das Glücksstreben des Hedonisten bewirke genau das Gegenteil dessen, was dieser erreichen möchte. Der Kontrast zu den terroristischen Pseudofundamentalisten, die das sündige Leben der Ungläubigen zutiefst beunruhigt, fesselt und fasziniert, könnte gar nicht größer sein. Man spürt förmlich, daß ihr Kampf gegen den sündigen Anderen im Grunde ein Kampf gegen ihre eigene Versuchung ist. Ein sogenannter christlicher oder muslimischer „Fundamentalist“ ist eine Schande für den wahren Fundamentalismus.
An diesem Punkt greift Yeats’ Diagnose zu kurz. Denn in Wirklichkeit zeugt die leidenschaftliche Intensität des Pöbels von einem Mangel an wahrer Überzeugung. Der fundamentalistische islamische Terror gründet nicht auf der Überzeugung der Terroristen, sie seien überlegen, oder auf ihrem Wunsch, ihre kulturell-religiöse Identität gegen den Übergriff der globalen Konsumzivilisation zu schützen. Das Problematische an „Fundamentalisten“ ist nicht, daß wir der Meinung sind, sie seien uns unterlegen, sondern daß sie sich selbst insgeheim minderwertig vorkommen (so wie sich offenkundig Hitler gegenüber den Juden minderwertig vorkam).
Genau deshalb machen sie unsere gönnerhaften, „politisch korrekten“ Beteuerungen, wir fühlten uns ihnen nicht überlegen, nur noch wütender und schüren ihr Ressentiment. Das Problem ist nicht die kulturelle Differenz, also ihr Bemühen, ihre Identität zu wahren, sondern im Gegenteil die Tatsache, daß die Fundamentalisten schon so sind wie wir, daß sie unsere Standards insgeheim bereits verinnerlicht haben und sich selbst an diesen Standards messen. Paradoxerweise ist das, was den Fundamentalisten wirklich fehlt, eine Prise wahrer „rassistischer“ Überzeugung von der eigenen Überlegenheit.
(...)
Die rasende muslimische Masse konfrontiert uns mit der Grenze der multikulturellen liberalen Toleranz, ihrer Neigung, sich selbst die Schuld zu geben und sich zu bemühen, den anderen zu „verstehen“. Der Andere ist hier ein realer anderer, real in seinem Haß. Wir haben es hier mit dem Paradox der Toleranz in seiner reinsten Form zu tun. Wie weit sollte die Toleranz gegenüber der Intoleranz gehen? All die politisch korrekten schönen liberalen Formeln, die Karikaturen seien zwar beleidigend und unsensibel gewesen, doch gewaltsame Reaktionen darauf seien nicht hinnehmbar, oder: Freiheit gehe auch mit Verantwortung einher und dürfe nicht mißbraucht werden, demonstrieren hier ihre Beschränktheit. Denn was ist diese berühmte „Freiheit mit Verantwortung“ anderes als eine neue Fassung des guten alten Paradoxes der erzwungenen Wahl? Man darf eine freie Entscheidung treffen, aber nur unter der Bedingung, daß man die richtige Entscheidung trifft; man erhält die Freiheit, unter der Bedingung, daß man sie nicht wirklich nutzt.
Wie also sollen wir diesen Teufelskreis des endlosen Changierens zwischen Pro und Kontra durchbrechen, der die tolerante Vernunft zum kräftezehrenden Stillstand bringt? Es gibt nur eine Möglichkeit: die Ablehnung der Begriffe, mittels derer das Problem formuliert wird. Wie Gilles Deleuze betont hat, gibt es nicht nur richtige und falsche Lösungen für Probleme, sondern auch richtige und falsche Probleme. Die Wahrnehmung des Problems als eines des rechten Maßes zwischen der Achtung vor dem anderen und unserer eigenen Ausdrucksfreiheit ist bereits eine Mystifizierung. Es verwundert daher nicht, daß die beiden einander entgegengesetzten Pole bei näherem Hinsehen ihre insgeheime Solidarität offenbaren. Die Sprache der Achtung ist die Sprache der liberalen Toleranz: Achtung hat nur einen Sinn als Achtung gegenüber denjenigen, mit denen ich nicht übereinstimme; wenn die beleidigten Muslime also Achtung vor ihrer Andersheit verlangen, dann akzeptieren sie den Rahmen des liberal-toleranten Diskurses. Andererseits ist Blasphemie nicht nur eine Haltung des Hasses, des Versuchs, den anderen da zu treffen, wo es ihm am meisten weh tut, im Kern des Realen seines Glaubens. Sondern sie ist stricto sensu ein religiöses Problem, das nur innerhalb der Faltungen eines religiösen Raums funktioniert.
Was sich drohend am Horizont abzeichnet, wenn wir diesen Weg nicht beschreiten, ist die alptraumhafte Perspektive einer Gesellschaft, die durch einen perversen Pakt zwischen religiösen Fundamentalisten und den politisch korrekten Predigern der Toleranz und der Achtung vor den Glaubensüberzeugungen des anderen reguliert wird: eine Gesellschaft, die gelähmt wird durch die Sorge, den anderen nicht zu verletzen, ganz unabhängig davon, wie grausam und abergläubisch dieser andere ist, und in der einzelne Menschen sich regelmäßigen Ritualen widmen, bei denen sie zu „Zeugen“ ihrer eigene Opferrolle werden.
(...)