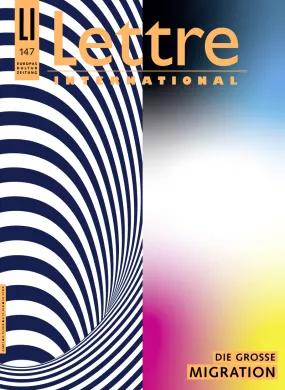LI 44, Frühjahr 1999
Lesen, rollen, scrollen
Der Computer des heiligen Augustinus im Humus der KulturElementardaten
Genre: Kulturgeschichte
Übersetzung: Aus dem Englischen von Chris Hirte
Textauszug
In den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts erteilten die Ältesten der Bruderschaft von San Giorgio degli Schiavoni in Venedig dem Maler Vittore Carpaccio den Auftrag, eine Szenenfolge aus dem Leben des heiligen Hieronymus zu malen. Die letzte dieser Szenen, heute ganz oben rechts zu sehen, wenn man den kleinen, abgedunkelten Saal betritt, stellt aber nicht den heiligen Hieronymus dar, sondern einen seiner Zeitgenossen, den heiligen Augustinus. In einer mittelalterlichen und noch immer beliebten Legende wird berichtet, daß Augustinus sich soeben an seinem Pult niedergelassen hatte, um Hieronymus brieflich um seine Ansichten zur Frage der ewigen Seligkeit zu bitten, als sich der Raum mit Licht erfüllte und eine Stimme ihm verkündete, daß der Geist des Hieronymus gen Himmel gefahren sei.
Carpaccio plazierte seinen Augustinus in einem venezianischen Studierzimmer, wie es ihm selbst vertraut war, das aber sowohl des Autors der Bekenntnisse als auch des Hieronymus, des Schöpfers der lateinischen Bibelfassung und Schutzheiligen der Übersetzer, würdig gewesen wäre: schmale Bände hoch oben auf dem Wandbord, darunter ausgebreitet zerbrechliche Gegenstände; ein messingbeschlagener Lederstuhl und ein kleines Schreibpult erhöht über dem überschwemmungsgefährdeten Fußboden, rechts ein Tisch mit einem drehbaren Lesegestell und der Arbeitsplatz des Heiligen, übersät mit aufgeschlagenen Büchern und mit Gegenständen, wie sie sich über die Jahre auf jedem Schriftstellertisch ansammeln: eine Muschel, eine Glocke, eine silberne Schatulle.
In der zentralen Nische erhebt sich die Statue des auferstandenen Christus und blickt hinüber zur Miniaturplastik der Venus, die zwischen dem Kleinkram steht. Beide bewohnen, wenn auch auf deutlich unterschiedenen Ebenen, dieselbe Menschenwelt: einerseits das Fleischliche, von dessen Verlockungen sich Augustinus im Gebet Erlösung erflehte ("aber bitte nicht sofort"), andererseits der logos, das Wort Gottes, das am Anfang war und dessen Echo Augustinus eines Nachmittags in einem Garten vernahm. In gehorsamem Abstand sitzt ein struppiger, kleiner weißer Hund mit erwartungsvollem Blick.
Dieser Ort umfaßt sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart eines Lesers. Die Anachronismen hatten für Carpaccio keine Bedeutung, der Hang zur historischen Treue ist eine neuzeitliche Erfindung, nicht älter vielleicht als Ruskins präraffaelitisches Credo der "absoluten, unzweifelhaften Wahrheit bis ins kleinste Detail". Augustins Studierzimmer und Augustins Bücher waren für Carpaccio und seine Zeitgenossen, ungeachtet dessen, wie sie im 4. Jahrhundert tatsächlich ausgesehen hatten, von vergleichbarem Wesen. Ob Schriftrollen oder Kodizes, gebundene Pergamentblätter oder die hocheleganten Taschenbücher, die der Venezianer Aldus Manutius gedruckt hatte, nur wenige Jahre bevor Carpaccio an der Scuola mit der Arbeit begann - alles waren nur verschiedene Varianten derselben Sache, des Buches, das sich stets wandelte, auch in Zukunft wandeln würde und sich doch immer gleich blieb. In der Sichtweise Carpaccios ist also Augustins Studierzimmer auch meinem Studierzimmer vergleichbar, der Welt eines jeden Büchermenschen mit ihren Regalen und Erinnerungsstücken, dem überladenen Schreibtisch, der unterbrochenen Arbeit und dem Leser selbst, der über der aufgeschlagenen Seite brütet und auf Offenbarungen wartet.
Trotzdem sind die Unterschiede zwischen Augustins Studierstil und meinem nicht zu übersehen. Wenn ich einen Text auf der Seite oder auf dem Bildschirm lese, lese ich ihn stumm. Dank einem sehr komplexen Vorgang oder ganzen Kaskaden von Vorgängen entziffern bestimmte Neuronengruppen in speziellen Gehirnabschnitten den Text, den meine Augen aufgenommen haben, und machen ihn für mich verständlich, ohne daß mein Mund die Worte formen und meine Ohren sie aufnehmen müßten. Das stumme Lesen ist keine so alte Fertigkeit, wie wir vielleicht vermuten würden. Der heilige Augustin hätte mein verschwiegenes Treiben zwar nicht unerklärlich, doch zumindest befremdlich gefunden. Eine berühmte Passage in den Bekenntnissen beschreibt, wie er den heiligen Ambrosius beim stillen Lesen in seiner Mailänder Klause beobachtet: "Wenn er las", berichtet Augustinus, "überspannten seine Augen die Seite, und sein Herz erforschte die Bedeutung, aber seine Stimme war stumm, und seine Zunge stand still." Gewöhnlich las Augustinus im 4.Jahrhundert genauso, wie die alten Griechen und Römer gelesen hatten - nämlich laut. Und dies zu dem Zweck, der ungegliederten Textschlange ohne Punkt und Komma Gestalt und Bedeutung zu verleihen. Ein erfahrener Leser konnte dies zwar auch im stillen tun, und auch Augustinus tat es gelegentlich - wie zum Beispiel im denkwürdigen Moment seiner Bekehrung, als er nach einem Band der Paulus-Briefe greift und "in Stille" den orakelhaften Vers liest, der ihn auffordert: "Ziehe Christus an wie eine Rüstung!" Aber das laute Lesen war nicht nur der Normalfall, es galt auch als unabdingbar für das volle Verständnis des Textes. Augustinus glaubte, daß Lesen soviel wie Vergegenwärtigen bedeutete, daß die scripta, die geschriebenen Wörter auf der Seite, zu verba werden mußten, zu gesprochenen Worten, um ihre Wirkung zu entfalten. Augustinus war der Überzeugung, daß der Leser dem Text Leben einhauchen, den geschaffenen Raum mit lebendiger Sprache ausfüllen mußte.
Um das 9. Jahrhundert hatte sich mit der Interpunktion und der größeren Verbreitung von Büchern auch die stumme Lektüre als Normalfall durchgesetzt, und damit war das Lesen um einen neuen Wesenszug - den der Privatheit - reicher geworden. Den neuen Lesern war es möglich, eine intime, fast amouröse Beziehung zu ihrer Lektüre zu entwickeln und unsichtbare Mauern um sich und ihr Buch zu errichten. Siebenhundert Jahre später betrachtete Carpaccio das stumme Lesen als das Signum des Gelehrten, und folglich wies er seinem gelehrten Augustinus einen stillen, abgeschiedenen Platz zu.
Weitere fünfhundert Jahre später, in unserer Zeit also, hat das stumme Lesen jede Besonderheit verloren, und da wir immer auf Neuerungen aus sind, ist es uns eingefallen, dem Text auf dem Bildschirm eine eigene (wenn auch körperlos schnarrende) Stimme zu verleihen. Wenn der Leser so will, kann ihm eine CD-ROM die postaugustinische Alternative bieten und entweder stumm bleiben wie ein Heiliger, während ich mich durch die Datei scrolle, oder dem Text Stimme und Illustration verleihen. Auch am Computer kann ich die Toten zum Leben erwecken, wenn auch nicht auf dem Weg des Erinnerns und mit einem Gefühl der Lust (auf das Augustinus verwies), sondern mittels purer Technik. Der Unterschied besteht darin, daß die Computerstimme nicht meine Stimme ist, daß ihre Modulation, ihre Betonung und ihre anderen Ausdrucksmittel unabhängig von meinem Verständnis des Gelesenen eingesetzt werden. Die verba konnten wir auf diese Weise nicht beflügeln, aber wenigstens haben wir den toten scripta das Laufen beigebracht.
Auch das Gedächtnis des Computers ist ein anderes. Augustinus ging davon aus, daß jeder, der die Schrift im rechten Geiste liest, sie in seinem Inneren bewahrt, von Leser zu Leser, von Generation zu Generation weitergibt und ihr die Unsterblichkeit sichert. "Sie lesen die Schrift ohne Unterlaß", schrieb er in den Bekenntnissen, "und was sie lesen, wird nicht vergehen." Augustinus pries die Leser, die selbst zum Buch werden, indem sie den Text in sich tragen, ihrem Gedächtnis eingeprägt wie in eine Wachsmatrize.
Die wichtigen Texte auswendig zu kennen und zum Zwecke des Disputs oder des Vergleichs präsent zu haben, war zu Carpaccios Zeit noch von Bedeutung. Doch als die Buchdruckerkunst erfunden war und die privaten Bibliotheken sich mit Büchern füllten, wurde der Rückgriff auf das gedruckte Wort bequemer, und schon die Lesekundigen des 16. Jahrhunderts konnten sich auf das Gedächtnis ihrer Bücher stützen, statt das eigene Erinnerungsvermögen zu bemühen. Das mehrfach schwenkbare Lesepult, mit dem Carpaccio Augustins Studierzimmer ausrüstete, diente der Erweiterung des Lesergedächtnisses ebenso wie andere wundersame Erfindungen ` zum Beispiel das "rotierende Lesepult" des italienischen Erfinders Agostino Ramelli von 1588, das sich drehen ließ wie das Rad einer Wassermühle und dem Leser zehn verschiedene Bücher gleichzeitig präsentierte, alle zitierbereit aufgeschlagen.
Der geräumige Speicher meines Wortprozessors versucht, mir denselben Komfort zu bieten. In mancher Hinsicht ist er den Erfindungen der Renaissance haushoch überlegen. Zum Beispiel wurden die antiken Texte, von denen viele so rar waren, daß sie Augustinus unbekannt blieben, von Carpaccios Zeitgenossen unter Mühen zusammengetragen. Heute stehen mir alle diese Texte frei und bequem zur Verfügung. Zwei Drittel der gesamten erhaltenen griechischen Literatur bis zur Zeit Alexanders des Großen, nämlich 3.400.000 Wörter und 24.000 Bilder, sind auf vier CD-ROMs der Yale University Press erfaßt, so daß ich nun mit einem Mausklick ermitteln kann, wie oft Aristophanes das Wort "Mann" benutzte, und spielend zum Ergebnis gelange, daß es bei ihm doppelt so oft vorkommt wie das Wort "Frau". Um solche Statistiken zu erstellen, hätte Augustinus seine mnemotechnischen Fähigkeiten schon sehr strapazieren müssen.
Mein Computergedächtnis versagt jedoch, wenn es ans Werten, Kombinieren, Deuten und Assoziieren geht, wenn sich Datenzugriff und Intuition miteinander verbinden sollen. Zum Beispiel kann mir mein Computer trotz seiner statistischen Präzision nicht erklären, warum mir vor allem die Frauen des Aristophanes in den Sinn kommen - die Praxagora in der Weibervolksversammlung, die Marktweiber in den Thesmophoriazusen und natürlich die alte Streitaxt Lysistrate - wenn ich an seine Stücke denke. Die aufnahmefähige Festplatte meines Computers ist kein aktives Gedächtnis wie das des Augustinus, sondern eher ein Speicherort wie seine Bibliothek, wenn auch viel größer und wohl auch handhabbarer. Mit Hilfe meines Computers kann ich memorieren, aber nicht erinnern. Letzteres kann ich nur bei Augustinus und seinen uralten Kodizes lernen.
Zu seiner Zeit hatte der Kodex, das Buch aus gebundenen Einzelblättern, die Schriftrolle schon fast verdrängt, und das wegen seiner eindeutigen Vorzüge. Die Rolle gab immer nur einen bestimmten Teil des Textes frei, und man konnte nicht vor- oder zurückblättern, eben mal in einem anderen Kapitel nachschauen und den Finger zwischen den Seiten lassen. Die Schriftrolle engte daher den Lesevorgang ein, der Text wurde dem Leser in einer vorbestimmten Reihenfolge präsentiert, ein Abschnitt nach dem anderen. Auch der Gesamtumfang des Textes wurde durch die Schriftrolle begrenzt. Man vermutet, daß die Unterteilung der Odyssee in Bücher nicht auf eine Gliederung durch den Dichter zurückgeht, sondern durch das Fassungsvermögen der Schriftrollen bedingt war.
Mein Computer bietet mir Vorzüge beider Buchformen. Ich kann mich durch einen Text scrollen und bin trotzdem in der Lage, über ein gesondertes Fenster zu einem anderen Teil des Textes zu gelangen. Doch in beiden Fällen fehlen mir Eigenschaften, die der Text in seiner materiellen Form besessen hatte. Die physische Dimension des Textes, die mir die Schriftrolle auf einen Blick sinnfällig machte, ist auf dem Bildschirm nicht präsent, und auch das Blättern und Springen geht nicht so bequem und flink wie bei einem Kodex. Andererseits ist mein Computer der bessere Apportierhund. In der Fähigkeit, die gesuchten Stellen zu erschnüffeln und herbeizuschaffen, ist er seinen papierenen und pergamentenen Vorgängern unendlich überlegen.
Augustinus wußte, was wir uns selten klarmachen, daß sich nämlich jeder Leser beim Lesen einen imaginären Raum erschafft. Dieser Raum umfaßt sowohl den Leser selbst als auch die Welt, die sich aus den gelesenen Worten konstituiert und die Keats als "that purple-lined palace of sweet sin" ("jenen Purpurpalast der süßen Sünde") bezeichnet hat. Dieser Lese-Raum besteht entweder im Medium, das ihn enthält oder offenbart (im Buch oder im Computer), oder in seiner textlichen Erscheinungsweise, so körperlos wie die Wörter, die sich im Lauf der Zeit im Leserbewußtsein festsetzen. Je nachdem, ob das geschriebene Wort am Ende oder am Anfang einer Kultur steht, ob wir es als Ergebnis eines schöpferischen Prozesses betrachten wie die Griechen oder als dessen Wurzel, wie es die Hebräer taten, wird es, wenn auch nicht in allen Fällen, zu einer Triebkraft dieser Kultur.
Für die Griechen, die ihre philosophischen Abhandlungen, ihre Dramen, Gedichte, Briefe, Reden und Geschäftsvorgänge fleißig niederschrieben, ohne dem Text mehr Bedeutung beizumessen als einer bloßen Erinnerungshilfe, war das Buch ein Begleiter der kulturellen Existenz, aber niemals ihr Kern. Die materielle Gestalt der griechischen Zivilisation lag im Raum, in den Steinen ihrer Städte. Für die Hebräer hingegen, die ihre Alltagsgeschäfte in mündlicher Form abwickelten und deren Literatur weitgehend dem Gedächtnis überantwortet war, wurde das Buch - das Buch der Bücher, das geoffenbarte Wort Gottes - zum Mittelpunkt der Zivilisation, es überlebte in der Zeit, aber nicht im Raum, es bewahrte sich durch alle Wanderungsbewegungen eines Nomadenvolkes. In einem Bibelkommentar bemerkte Augustin, der direkt auf der hebräischen Tradition fußte, daß Wörter einer musikalischen Qualität zustreben, die ihren Platz in der Zeit findet und keiner geographischen Lokalisierung bedarf.
Mein Computer gehört offenbar nicht der hebräischen und bücherzentrierten Tradition des Augustinus an, sondern eher dem bücherlosen Griechentum, das steinerne Monumente brauchte. Die Worte, die ich herbeizaubere, verdanken ihre Existenz dem vertrauten Computer-Tempel, dessen portalartiger Bildschirm über dem Kopfsteinpflaster der Tastatur in die Höhe ragt. Wie die Griechen den Marmor zum Sprechen brachten, bringe ich die Plastiksteinchen zum Sprechen. Und die Rituale des Zugangs zum Cyberspace lassen sich in gewisser Weise mit den Zugangsritualen zu einem Tempel oder Palast vergleichen, die Vorbereitung und eingeübte Griffe erfordern.
Die Leserituale, die Augustinus im Umkreis seines Schreibtisches und in den vier Wänden seines Studierzimmers vollzog, waren hingegen verzichtbar und beliebig. Er konnte beim Lesen auf und ab gehen, er konnte sich mit seinem Kodex ins Bett zurückziehen oder sich hinaus in den Garten setzen. Für Augustinus war das Buch ein Textbehälter von variabler Form; für die Humanisten der Epoche Carpaccios wurde diese Variabilität zu einem Wesensmerkmal, das zur Erfindung des Taschenbuches durch Aldus Manutius führte. Und im Verlauf der Jahrhunderte wurde das Buch immer praktikabler, zahlreicher und ersetzbarer; lesbar in jeder Lebenslage, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Obwohl das Powerbook mir ermöglicht, meinen Lesestoff zu einem Felsen im Grand Canyon zu transportieren (wie es mir in einem Macintosh-Werbespot nahegelegt wird), hängt die Existenz des Textes immer noch von der Technologie ab, die ihn hervorbringt und speichert, ich muß mich nach wie vor dem physischen Monument, der Maschine, unterwerfen.
Für Augustinus besaßen die Worte auf dem Papier eine physische, flammende und sichtbare Präsenz, während die Schriftrolle oder der Kodex ersetzbar und vergänglich waren. Für mich ist nur die physische Präsenz des teuer bezahlten Computers von Bedeutung, die Wörter hingegen sind Schall und Rauch. Wenn sich der Phantomtext stumm und geisterhaft auf dem Bildschirm materialisiert und mit einem Tastendruck zum Verschwinden gebracht werden kann, unterscheidet ihn das grundlegend von den beruhigend stabilen, sogar herrischen schwarzen Lettern, die mit Sorgfalt auf ein Stück Pergament aufgetragen oder auf ein Blatt Papier gedruckt wurden. Dies äußert sich auch im unterschiedlichen Vokabular, mit dem Augustinus und ich den Leseakt benennen. Augustinus sprach vom "Verschlingen" und "Genießen" eines Textes - gastronomische Metaphern, die er bereits im Buch Hesekiel vorfand. Ich dagegen "surfe" durch das Internet und "scrolle" mich durch eine Datei. Für Augustin ist der Text ein dingliches Wesen, das man sich einverleiben muß. Der Computerleser erlebt den Text nur als Oberfläche eines Datenflusses, auf dem man umherflitzt wie ein Wellenreiter.
Soll das bedeuten, daß unsere Lesefähigkeiten verkümmert sind und ihren lukullischen Charakter zum großen Teil verloren haben? Oder haben sie sich vielmehr verbessert, weiterentwickelt und perfektioniert im Vergleich zur gemächlichen Lektüre des heiligen Augustinus? Seit vielen Jahren schon wird der Tod des Buches und der Sieg der elektronischen Medien vorausgesagt, als wären zwei ungleiche Ritter gegeneinander angetreten, um auf ein und demselben geistigen Turnierplatz um die Gunst einer einzigen, zitternden Leserin zu kämpfen. Erst war es das Kino, das angeblich dem Buch den Garaus machte, dann das Fernsehen, später Videospiele und Virtual Reality, und selbst Buchhistoriker unserer Tage schrecken nicht vor apokalyptischen Bildern, vor Stoßgebeten und Bannflüchen zurück, wenn sie die bedrohte Zukunft des Buches beschwören. Vielleicht sind alle Leser im Herzen Maschinenstürmer, aber das hieße den Enthusiasmus ein wenig zu weit treiben. Weder wird die Technik den Rückzug antreten, noch geht das gedruckte Wort dem Untergang entgegen. Allen Unkenrufen zum Trotz zeigt die Zahl der Jahr für Jahr gedruckten Bücher keinerlei rückläufige Tendenzen.
Und doch wird es Veränderungen geben. Obwohl noch nie so viele Bücher gedruckt wurden wie heute, werden bestimmte Buchtypen dem elektronischen Fortschritt weichen. Nachschlagewerke zum Beispiel finden eine geeignetere Heimstatt auf der CD-ROM, wenn es erst gelingt, intelligentere Querverweissysteme zu entwickeln, die einem nicht mit mechanischer Sturheit alle Suchbegriffe liefern, und mögen sie noch so irrelevant sein. Mit solchen verbesserten Werkzeugen ausgerüstet, kann der Computer die enzyklopädische Datenscheibe ungleich zuverlässiger nach allen Artikeln durchforschen, in denen etwas zum Thema Lesen mitgeteilt wird, als es dem fleißigsten Leser der 29bändigen Papierausgabe der Britannica vergönnt ist. Nichts von dem, was uns lieb und teuer ist, muß verlorengehen. Möglich, daß der eine oder andere Vorzug, den wir an Büchern schätzen, mit Hilfe raffinierter Vorrichtungen in die Computerwelt hinübergerettet wird. Wir können schon elektronische Notepads bekritzeln, und der Laptop im Westentaschenformat ist keine abwegige Vorstellung mehr. Warum nicht auch ein tragbarer Apparat, der alle Bearbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten von Texten in sich vereint - visuelle und auditive Darbietung, Randbemerkungen und das Angebot verspielter Textuntersuchungsmethoden direkt auf dem Bildschirm oder mit Hilfe noch zu erfindender Vorrichtungen? Die CD-ROM (oder was immer in Zukunft ihren Platz einnehmen wird) ist einem Wagnerschen Gesamtkunstwerk vergleichbar, einer Art Minioper, in der alle Sinne zusammenwirken müssen, um einen Text zur Entfaltung zu bringen.
Ändern werden sich mit Sicherheit die Eigentumsbegriffe. Die Vorstellung vom Buch als Wertgegenstand, sei es wegen seines Inhalts, seines Alters oder seiner Ausstattung, gab es schon in der Epoche der Schriftrollen, aber erst das im 14.Jahrhundert (zumindest in Europa) entstehende bürgerliche Publikum holte das Buch aus dem adligen und klerikalen Dunstkreis heraus und schuf einen Markt, der den Besitz von Büchern zum Statussymbol erhob und die Herstellung von Büchern zu einem Gewerbe unter vielen machte. Eine ganze Industrie entstand, um die Nachfrage nach Büchern zu befriedigen, was Doris Lessing dazu veranlaßte, ihre notleidenden Kollegen aufzustacheln:
"Ohne mich gäbe es keine Literaturindustrie. Die Verlage, die Agenturen und Sub-Agenturen und Sub-Sub-Agenturen, die Buchhalter und Anwälte, die literaturwissenschaftlichen Fakultäten, die Professoren, die Dissertationen und literaturkritischen Bücher, die Rezensenten, die Bücherseiten ` diesen ganzen riesigen und wuchernden Betrieb gibt es nur wegen mir, dieser kleinen, bevormundeten, übervorteilten und unterbezahlten Person."
Aber in den Zeiten der neuen Technologie muß die Industrie (die nicht verschwinden wird) sich umstellen, um zu überleben. Essays im Internet, Gedichte, die durch Modems rauschen, Bücher, die, auf Disketten kopiert, von Leser zu Leser wandern, brauchen den Verleger und auch den Buchhändler nicht mehr. Interaktive Romane schließlich stellen sogar das Prinzip der Autorenschaft in Frage. Wer kassiert Tantiemen für einen Text, der in Salamanca gescannt, per E-Mail in Recife empfangen, in Melbourne umgeschrieben, in Ecuador erweitert und in San Francisco auf einer Diskette gespeichert wird? Und wer ist der Urheber dieses Kollektivprodukts? Auch beim Bau einer mittelalterlichen Kathedrale oder bei der Produktion eines Hollywood-Films haben viele Hände mitgewirkt, und ohne Zweifel wird die neue Medienindustrie auch neue Wege finden, sich ihre Profite zu sichern. Und die kleine, unterbezahlte Person von Doris Lessing muß sich wohl damit bescheiden, noch kleiner und noch unterbezahlter zu werden.
Was aber, wenn jeder elektronische Text der Einwirkung eines jeden Benutzers zugänglich wäre wie die Bildschirmromane Robert Coovers, die man durch eigene Einfälle ergänzen, mit einem eigenen Anfang oder Ende versehnn kann? Unser besorgter Leser, der mit ausreichend Freizeit gesegnet ist, den Luxus einer privaten Behausung genießt und kaum unter Zensurmaßnahmen zu leiden hat, wird sich fragen: Können wir einen solchen proteischen (oder, wie das häßliche Modewort dafür lautet ` interaktiven) Text, an dem jeder mitwirken kann, überhaupt noch kritisch lesen? Doch vor lauter Sorge vergessen wir, daß jeder Text in seinem innersten Wesen "interaktiv" ist und sich von Leser zu Leser, Stunde zu Stunde, Ort zu Ort wandelt. Ein "reines Lesen" hat es nie gegeben. Liest man Laurence Sterne, wird der Leseakt zum Gespräch, liest man Danielle Steele, vermischt er sich mit dem erotischen Kitzel, bei Bruce Chatwin mit Reportage, bei anderen mit Belehrung, Geschwätz, Enzyklopädismus, Ordnungsrausch oder Wahnwitz. Es scheint keinen platonischen Idealtyp des Lesens zu geben und auch keinen solchen des Buches. Die Auffassung, daß der Text ein passiver Gegenstand ist, trifft nur in einem abstrakten Sinne zu. Von den ältesten Schriftrollen bis zu den Musterseiten der Bauhaus-Typographie trägt jeder fixierte Text, jedes Buch in jeder Gestalt eine explizite und implizite ästhetische Botschaft in sich. Es gibt kein Manuskript, das einem anderen völlig gleicht. Diese Erkenntnis zwang schon die wackeren Bibliothekare von Alexandria dazu, sich für eine jeweils gültige Version der von ihnen verwahrten Schriftwerke zu entscheiden, und so entwickelten sie die epistemologische Regel, daß jede neue Abschrift die ältere ersetzt, da diese zwangläufig in der neueren enthalten sei. Und als Gutenbergs Druckerpresse ein und denselben Text tausendfach vervielfältigte, war es am Leser, den Text zu seinem persönlichen zu machen, ihn mit Randbemerkungen, Klecksen, Markierungen aller Art zu versehen, so daß kein Buch, nachdem es einmal gelesen ist, noch mit einem anderen Buch identisch ist. All diese vielen Textvarianten, die Myriaden befingerter Buchseiten können uns nicht davon abhalten, von dem Hamlet und dem König Lear zu sprechen, dem einen und einzigen Shakespeare. Elektronische Texte werden neue Maßstäbe für ihre konstanten und variablen Qualitäten hervorbringen, und die Kritiker werden neue Vokabeln erfinden, um sich auf die Wandelbarkeit des Textes einzustellen.
Dieselbe unbegründete Technikangst, die sich schon gegen die Umstellung von der Schriftrolle auf den Kodex wendete, wendet sich nun wieder gegen die Umstellung vom Kodex auf die Schriftrolle. Der über den Bildschirm rollende Text gefährdet angeblich eine humanistische Errungenschaft, das handgreifliche, aus Papier und Druckerschwärze gefertigte Buch. Doch jede Technologie besitzt menschliches Maß; es ist unmöglich, diesen menschlichen Charakter zu eliminieren, auch den unmenschlichsten Erfindungen ist er zu eigen. Es sind unausweichlich unsere eigenen Schöpfungen, so sehr wir das auch leugnen mögen. Dieses menschliche Maß der Technologie zu erkennen und zu deuten wie die farbigen Fingerspuren an den Wänden prähistorischer Höhlen mag unsere gegenwärtigen Fähigkeiten übersteigen. Benötigt wird dafür keine erneuerte humanistische Lesehaltung, sondern eine effektivere, die dem technologisch eingebundenen Text seine ambivalente Vielschichtigkeit zurückgibt und so seiner seherischen Potenz gerecht wird. Viel wichtiger, als die Effekte der Virtual Reality zu bestaunen, ist es, ihre sehr realen und nützlichen Defekte zu erkennen, die Risse, Löcher und Spalten, durch die wir in einen noch ungeschaffenen Raum eintreten können. Vielleicht sollten wir unsere Entschiedenheit ein wenig dämpfen, statt sie noch zu steigern. Ob sich das Buch in seiner jetzigen Form erhalten wird oder nicht, scheint mir eine müßige Frage zu sein. Meine Vermutung (und mehr als eine Vermutung ist es wirklich nicht) geht dahin, daß es uns im großen und ganzen erhalten bleibt, weil es so gut an unsere Bedürfnisse angepaßt ist ` doch auch diese können sich zweifellos ändern.
Unsere Ängste sind endemischer Natur und in unserer Zeit verwurzelt. Sie schweifen nicht in eine unbekannte Zukunft, sondern verlangen nach abschließenden Antworten, hier und jetzt. "Dummheit", schrieb Flaubert, "ist das Verlangen nach einem Schluß". In der Tat. Das Lektüreerlebnis ist, wie jeder Leser weiß, wesentlich dadurch bestimmt, daß das Ende unvorhersehbar und bis zuletzt offen bleibt. Jeder Leseakt ist die Fortsetzung einer Geschichte, die an irgendeinem Nachmittag vor vielen tausend Jahren begonnen hat und von der wir nichts wissen; jeder Leseakt wirft seinen Schatten auf die nachfolgende Seite voraus, verleiht ihr Gehalt und Zusammenhang. Auf diese Weise wächst die Geschichte Schicht um Schicht wie der Humus einer Kultur, die wir durch unsere Lektüre fortsetzen und bewahren. Auf dem Gemälde Carpaccios sitzt Augustinus, aufmerksam wie sein Hund, mit gezückter Feder vor einem Buch, das wie ein Bildschirm leuchtet, und schaut direkt ins Licht, in lauschender Haltung. Der Raum, die Instrumente wandeln sich ständig, die Bücher auf dem Wandbord werfen die Einbände ab, der Text spricht in Stimmen, die noch nicht geboren sind.