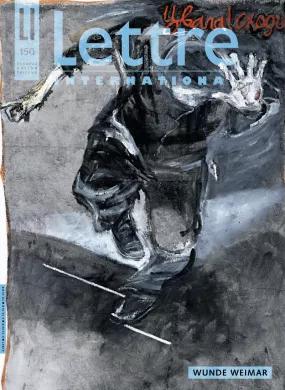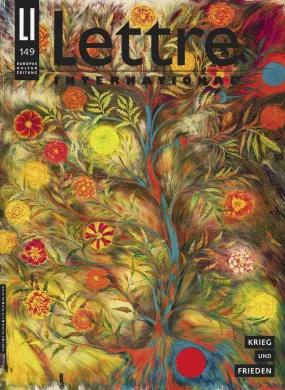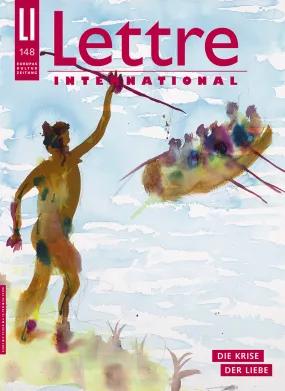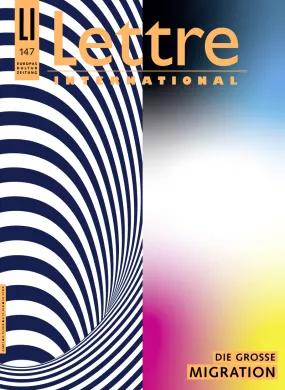LI 80, Frühjahr 2008
Das tschechische Los
Der kritische Geist - Oder von großen und kleinen Völkern in der WeltElementardaten
Genre: Historische Betrachtung
Übersetzung: Aus dem Französischen von Markus Sedlaczek
Textauszug
Es war am 24. August [1968], ich befand mich in einem Häuschen, das dem Vater eines Freundes gehörte, von ferne waren Schüsse zu hören, auf dem Tisch stand das eingeschaltete Transistorradio, und ich durchstöberte mit zerstreutem Blick den alten Bücherschrank, bis ich schließlich ein Buch hervorzog, das im Jahre 1633 von Pavel Stránský verfaßt worden war: Vom böhmischen Staat. Und ich las: „… so würde man auch von einem Kenner der Geschichte und der Althertümer Böhmens, auf die Frage: ob dieses Land ein Lehn des deutschen Reichs sey? die entschlossene Antwort hören: Böhmen sey vielmehr durch ein ewiges Freundschaftsband mit dem deutschen Reiche verbunden, als daß es auf eine knechtische Art, ja nicht einmal als ein Lehn von demselben abhängen sollte.“
Und ein Stück weiter: „Wenn man aber auch annimmt: die deutschen Kaiser hätten die Oberherrschaft über Böhmen gehabt, oder hätten sie noch; die Böhmen aber haben sich des Ungehorsams gegen sie schuldig gemacht; so hätte man doch den Weg der Gewalt und Waffen vor jenem des Rechts wider sie nicht einschlagen sollen. Denn da man die Gewalt nicht brauchen darf, so lange man in den Gesetzen Hilfe finden kann; so verliert derjenige, der das Seinige, eher mit Gewalt als auf dem gesetzmäßigen Wege suchet, eben darum sein Recht. Durch Bündnisse, Verträge und Freundschaft ist Böhmen mit Deutschland von den ältesten Zeiten her viel enger vereinigt, als irgend ein anderes Königreich: doch diese Bündnisse beeinträchtigen die Majestät, die Gesetze, die Rechte, die Gewohnheiten, die Freyheit eines oder des andern der beyden Völker im geringsten nicht. So lange man diese Gränze beobachtete, blieb auch die Eintracht beyder Völker unerschüttert: überschritt sie ein Theil – wie denn, wenn von zwei Freunden einer stärker ist als der andere, das Bündnis nicht selten einer Freundschaft mit dem Löwen gleicht – so kam es immer zu Feindseligkeiten …“
Und noch etwas weiter: „Die Böhmen wollen lieber unter ganz freyen Völkern was immer für einen Rang, als den ersten unter denjenigen, die sich zu fremden Diensten erbiethen, ihre Knechtschaft mag noch so glänzend seyn.“
Die Schüsse draußen verbanden mich mit dem gegenwärtigen Augenblick, doch Pavel Stránskýs uralte Sätze ließen mich sogar mit dieser Schießerei in die Arme der tschechischen Geschichte sinken, in ihre unermeßlichen Fernen, und gaben mir zu verstehen, daß wir immer noch ein und dieselbe Nationalgeschichte leben, die ihre „ewige“ Problematik besitzt, mit dem beständigen Streit zwischen Bündnis und Oberherrschaft, mit der fortwährend errungenen, aber letztlich unerreichten Souveränität und dem unaufhörlichen Kampf um sie, und daß auch diese Schießerei, die an mein Ohr drang, nicht nur ein Blitz aus heiterem Himmel, ein Schock, eine Absurdität war, sondern daß sich in ihr nur von neuem und auf andere Weise das uralte tschechische Los erfüllte.
Die Jahre von 1939 bis vor kurzem konnten die tschechische Seele nicht gerade mit besonderem Stolz erfüllen. Kleinheit, Anpassungsfähigkeit, fehlender Mut zu einer eigenständigen Politik, die Herrschaft einer neiderfüllten Mittelmäßigkeit, eine allgegenwärtige Rüpelhaftigkeit, all das ließ in uns äußerst skeptische Gedanken über den tschechischen Charakter aufkommen und warf ein schmerzliches Licht auf die Geschichte, die diesen Charakter geschaffen hat.
Ich habe damals oft an die tschechische Wiedergeburt gedacht, die sich inmitten eines brodelnden Europa ihren kleinen Sandhaufen zusammenpatschte – eine Erweckungsbewegung, die nicht in der Lage war, allgemein menschliche Werte zu schaffen, deren Handeln sich im Kleinklein erschöpfte und der es an großen Taten mangelte. Ich dachte an das Erbe dieser Kleingeisterei, die sich auch dem tschechischen 20.?Jahrhundert aufprägte, dem Jahr 1938, den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Jahr 1956, als man nicht in der Lage war, konsequent und in großem Stil auf den Anstoß des 20. Parteitags zu reagieren, sowie insbesondere der Ära Antonín Novotnýs, in dessen Ratlosigkeit ich den Genius der tschechischen Kleinheit selbst verkörpert sah.
In jener Zeit schrieb ich ein Stück, von dem ich zu meinen Freunden sagte, es sei antitschechisch. Ein gewisser, bereits außer Dienst stehender Major belehrt dort seinen jungen Schwiegersohn. „Die Tschechen haben nie auf den Barrikaden gekämpft. Die Tschechen gingen in den Sokol turnen. Solche exakten Freiübungen haben unserem Volke mehr genützt als zehn Revolutionen.“
Als ich vor zwei Monaten aus Paris zurückkam, wurde mir zu meiner Überraschung nachträglich bewußt, daß ich dort in den verschiedensten Debatten und Presseinterviews deutlich patriotische (und letztlich hoffnungsvolle) Töne angeschlagen hatte. Wo hatte ich das plötzlich her? War es nur nationale Disziplin, die mich dazu brachte, in der Fremde das Vaterland zu loben? Nein, so diszipliniert bin ich nicht. Den Wandel meiner Haltung bewirkte das auf immer unvergeßliche Erlebnis des letzten August. In unzähligen daheim und im Ausland geführten Gesprächen kam ich immer wieder darauf, daß es auf der Welt so schnell kein Volk gibt, das eine ähnliche Prüfung bestanden und eine solche Festigkeit, einen solchen Verstand und eine solche Einigkeit bewiesen hätte wie wir.
Der August warf ein neues Licht auf unsere gesamte Geschichte. Nicht daß die skeptische Kritik am tschechischen Nationalcharakter ihre Gültigkeit verloren hätte, aber sie wurde durch einen Blick von einer anderen Seite ergänzt: Ja, mit der heroischen Tradition von Žižkas Streitkolben hatte das tschechische Volk bereits seine direkte Abhängigkeit verloren; das Hussitentum bedeutet aber auch jene Volkstradition, in der „jedes Großmütterchen die Heilige Schrift besser kannte als ein italienischer Priester“, und diese Tradition der Volksbildung und der Nachdenklichkeit im ganzen Volk ist bei uns bis auf den heutigen Tag zu Hause.
Ja, die tschechische Wiedergeburt kannte statt der großen Politik nur die kleine Aufklärung; die Hauptwaffen des nationalen Kampfes waren das Laientheater, Lieder und Verse, jawohl, die tschechische Kunst war vor den holpernden Leiterwagen umherwandernder Volkserzieher gespannt, aber es ist auch wahr, daß die Masse des tschechischen Volkes auf diese Weise vom Beginn seiner neuen Existenz an so schicksalhaft mit der Kultur verknüpft war wie kaum eine europäische Nation, so daß es in dieser Hälfte Europas das bei weitem nachdenklichste und gebildetste Volk ist und sich von keiner billigen Propaganda so einfach hinters Licht führen läßt.
Ja, es ist wahr, daß das tschechische Volk im vergangenen Jahrhundert abseits der großen europäischen Konflikte stand; aber es ist auch wahr, daß ihm in jener Zeit etwas Gigantisches gelang: Aus einer Bevölkerung, die nur zur Hälfte des Lesens und Schreibens kundig und ihrer Nationalität halb entfremdet war, wurde wieder eine europäische Nation, und dies gegen den Strom einer beständigen Germanisierungsbemühung, gegen den Willen der Macht, der sie untergeordnet war, so daß sie seither gerade unter ungünstigen Bedingungen ihre besten Leistungen zu erbringen wußte.
Ja, es ist wahr, daß sich die tschechische Nation nicht durch den Geist eines romantischen Heroismus auszeichnet, aber es ist auch wahr, daß die Kehrseite dieser Abwesenheit von Romantik und Heroismus ein nüchterner Verstand, ein Sinn für Humor und ein kritischer Geist ist, mit denen dieses Volk sich selbst betrachtet, so daß es eines der am wenigsten chauvinistischen Völker Europas ist: Wenn sein Nationalstolz empört aufflammt, bedeutet dies, daß er aufs Schrecklichste verletzt worden ist; und es bedeutet auch, daß dieses Aufflammen keineswegs nur von kurzer Dauer und flüchtig ist wie ein Gefühl, sondern hartnäckig wie die Vernunft selbst.
(...)