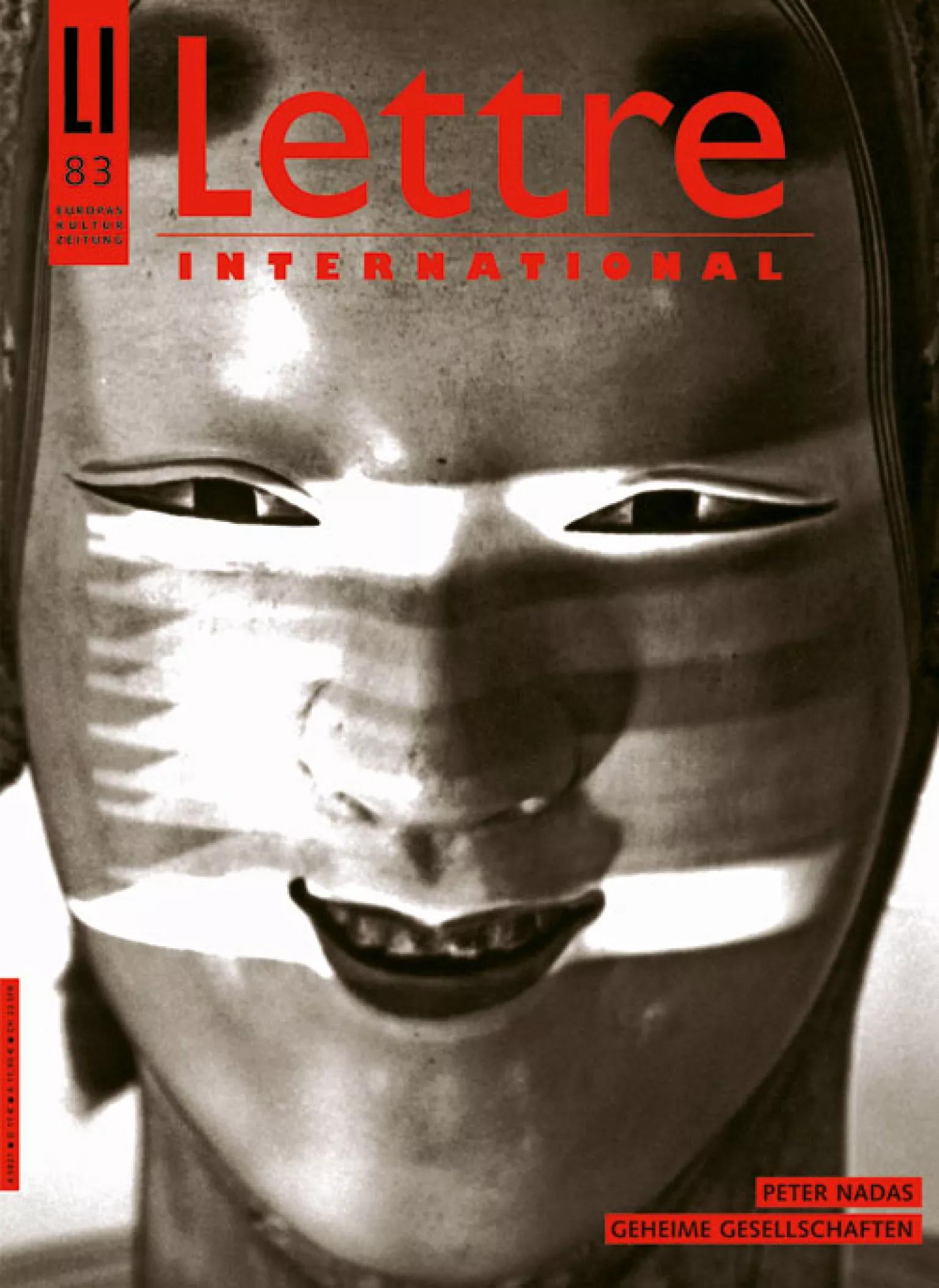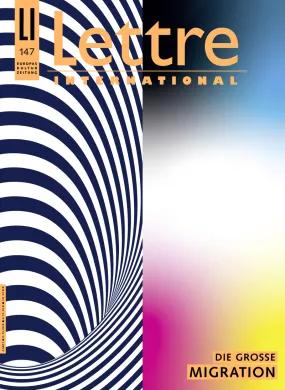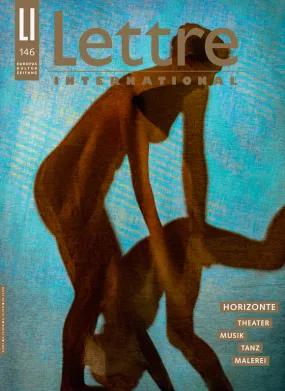LI 83, Winter 2008
Trockenes Denken
Vom Verlust des Wasserbewußtseins und von der Poesie des FluidenElementardaten
Textauszug
(...) Die Topographie des Denkens trocknet aus. Und die Denker sind darin verwickelt. Sie haben das Medium des Denkens entmaterialisiert: die Sprache. Sie haben versucht, die Quellen des Gedächtnisses auszutrocknen, die das Sprechen und Schreiben inspirieren, und Sprache auf ein Instrument rationaler Kommunikation zu reduzieren. Sie haben die poetischen Dimensionen der Sprache eliminiert, die ihr zu fließen erlauben – von einer Idee zur anderen, von einem Mund zum anderen. Sie haben die flüssigen Silben von lebenden Worten genommen und sie in den Pressen ihrer Argumente ausgetrocknet wie Blumen zwischen Löschpapierblättern. Natürlich kehrt das Verdrängte wieder: Was an Bacons Verdammung des Flüssigen am bemerkenswertesten ist, ist ihre Eloquenz. Das Beschreiben des Unbeschreiblichen läßt den Poeten in Bacon frei. Er macht den tiefsten Eindruck auf den Leser, wenn er über etwas schreibt, das ihm zufolge überhaupt keinen Eindruck hinterläßt. Wenn man Ivan Illich glauben darf, dann ist das Austrocknen des Denkens nicht modern. Er bringt die Austrocknung des Denkens mit der Erfindung des Schreibens in Verbindung. Er belebt Platos Sicht neu, daß die Aneignung des Schreibens, um Gedanken festzuhalten, den Künsten des Gedächtnisses – personifiziert in der Mutter der Musen – einen vernichtenden Schlag versetzt hat. Mnemosyne präsidierte über der tiefen Quelle der Erinnerung, die sich jenseits des Todes auf der anderen Seite von Lethe befand, dem Strom des Vergessens. Sie symbolisierte die Identifikation der Poesie mit der Gabe, sich an das Jenseitige zu erinnern. Sobald aber die Poesie niedergeschrieben war, schwand die Notwendigkeit, sich zu erinnern. Auch die Erinnerung der Göttin schwand: „An den epischen Fluß“, wie Illich sagt, „der seine eigene Quelle speist, erinnert man sich nicht mehr“: „Geschriebene Sprache, die Worte auf Lehmtafeln fixiert hat, gewinnt mehr Autorität als die Wiederheraufbeschwörung der flüssigen, lebenden Rede.“
Die zugrundeliegende Ironie hat auf Plato einigen Eindruck gemacht. Die Dialogform, in der er Sokrates’ Weisheit darlegte, war eine literarische Erfindung, die dazu bestimmt war, zwischen dem lebendigen Fließen der Rede und dem Fluß der geschriebenen Tradition zu vermitteln. Wie Heraklit, den er so boshaft entstellt hat, hoffte er, daß Differenz und Gleichheit koexistieren könnten. Auch andere Philosophen haben literarische Formen geistreich dazu verwendet, die Räder des Denkens zu schmieren und ihre Axiome zu beleben. Der neapolitanische Jurist Giambattista Vico mag die kartesianische Logik verachtet haben, aber er übernahm Descartes’ entwaffnend ungezwungene autobiographische Form. Die physische Natur liefert Descartes Vergleiche, um mentale Zustände zu illustrieren. Natur – insbesondere Flüsse – existieren für ihn ebenso wie für Leibniz als Redewendung. Laßt uns, so Leibniz’ Lobrede, „langsam reisen, aber mit festem, standhaftem Tritt, entlang diesem reinen und lebendigen Strom klaren und einfachen Wissens“. Nehmen wir jedenfalls einmal an, Descartes hätte dem zugestimmt. Er hätte das Wort „entlang“ unterstrichen. Flüsse waren in seinem Bewußtsein Antithesen der Vernunft: Im Zweifel zu sein, erklärte er, war wie „plötzlich in tiefes Wasser geworfen werden“, unfähig, den Grund zu berühren oder an der Oberfläche zu schwimmen. Vico hat mit seiner Neigung, poetische Analogien auf ihre logischen Folgerungen hin zu untersuchen, die Umwelt des Denkens ernst genommen. Dementsprechend hat er seine Autobiographie eine „Periautobiographie“ genannt, ein Schreiben um das Selbst herum, als sei der Geist nicht das reine Produkt des Denkens, sondern hätte seine Wurzeln in den Interaktionen des Denkers mit der Welt, in der er lebt.
In Vatolla – einem kleinen Dorf in den Bergen südöstlich von Salerno – brachte Vico sieben Jahre zu, auf die er die Originalität seines Denkens zurückführte. Man kann den Raum besuchen, in dem er jeden Tag schlief und arbeitete, wenn er seine Pflichten als Lehrer erfüllt hatte. Von seinem Schlafzimmerfenster aus hatte Vico einen gewaltigen Ausblick: unmittelbar vor seinem Fenster das Mosaik von ziegelgedeckten Dächern, Natursteinwänden, kleinen Terrassen und blühenden Bäumen, die Vatolla umgeben; dann dahinter, schwindelerregend abfallend und sich schnell in den blauen Dunst entziehend, das riesige Bassin des zerklüfteten und tief eingeschnittenen Systems von Tälern des Cilento, ein Arrangement von Horizonten, eine komplexe Genealogie von topographischen Abstammungslinien, verworren und verwirrend, was ihre Ursprünge betrifft, auch wenn ihr zugrundeliegendes Motiv einfach ist. Und weiter, wo das Adlerauge leicht umherschweift, weiter westlich und nördlich, wo der Golf von Salerno sich in seiner schläfrigen, romantischen Brillanz erstreckt. Bis zum Vesuv und nach Capri kann das Auge durch den gerinnenden Dunst sehen – und die in einem See aus Sonnenlicht daliegende große Ebene südlich von Salerno, wo die Tempel von Paestum stehen. Und ja, diese Landschaft illuminiert in der Tat die Topographie von Vicos Denken: Vicos Auseinandersetzung mit Descartes beispielsweise nimmt eine andere Bedeutung an. Descartes, isoliert in Holland, Bewohner einer flachen Schachbrettlandschaft, beinahe metaphysisch in seinem Vertrauen auf schützende Deiche für sein Überleben, arbeitet eine geometrische Methode des Räsonnierens aus. Was könnte natürlicher sein, als in Form von geraden Linien, Axiomen und ihren Folgesätzen, die in rechten Winkeln abzweigen, zu denken und die Welt idealerweise als Gegenstand eines universalen Rasters des Denkens aufzufassen? In Vatolla war eine solche Vorgehensweise nicht nur gefühlsmäßig fremd, sondern handgreiflich inkorrekt: In dieser hochaufragenden, asymmetrischen Zone schneebedeckter Berge, sich an Bergrücken klammernder primitiver Weiler, saisonaler Sturzbäche, wehrhafter Vorgebirge und einer Aussicht auf die Küste, geeignet, die Hesperiden zu schmücken, bezeugte alles die Realität der Ursprünge. Wie könnte Vicos Philosophie der Kultur etwas anderes als eine Theorie der Abstammung und Transformation sein? Darüber hinaus spiegelte dies die Genealogie seines eigenen Denkens. Um die hochaufragenden Höhen seiner Vision zu erreichen, mußte er zurückklettern zu den unterstellten Ursprüngen der Menschheit – die ersten Menschen, die autochthonen Einwohner des Landes, waren, sagte er, Binnenlandbewohner von Bergspitzen, die später zu den Küsten herabstiegen; aber das traf auf sein eigenes Denken zu: Alles mußte noch einmal ausgedacht werden. Das bedeutete dennoch keine kartesianische Geringschätzung für einstige Autoritäten; es bedeutete, seinen eigenen Pfad aufwärts zu ihren ursprünglichen Höhen zu finden, im Prozeß der Findung eines eigenen Pfads, der in der Lage wäre, ihn auf dem wahren Weg zurück nach unten zur Gesellschaft zur bringen, zurück zu der politischen, religiösen und ökonomischen Welt, die von Neapel repräsentiert wurde.
Die Gegenstände der Philosophen in den Topoi – den Orten – erneut zu verorten, dort, wo sie gedacht wurden, ist ein erster Schritt hin zum feuchten Denken. Seine Auswirkung wäre, daß die Poeten der Ideen für die Metaphern verantwortlich gemacht würden, die sie verwenden. Michèle Le Dœuff nennt das Vertrauen der Vernunft in die Metapher das „beschämende Gesicht der Philosophie“, da es zeigte, daß kompromißlose und unbeirrbare Logik in der gewöhnlichen Sprache steckt, die wir alle verwenden und die, wie Leibniz beklagte, uns in Moraste und Wanderdünen des Zweifels ohne Ende stürzt, in denen nichts solide oder fest ist. Zumindest in Australien – einem Kontinent, der auf Sand gebaut ist – ist es höchste Zeit, daß wir diese intellektuelle Agoraphobie aufgeben und zugestehen, daß das Feuchte eine Spur hinterläßt. Denn das Feuchte ist nicht nur Wasser: Es ist Sand. Das Feuchte, all das, was formlos ist, sich leicht in jede Richtung ergießt, sich leicht sammelt und wieder wegdriftet, ist trocken. Und das trockene Feuchte nimmt einen Abdruck an, wie Jahrtausende der Grundsätze der Aborigines bewiesen haben. Denn die Sandzeichnungen, die ein Merkmal der zentralaustralischen Eingeborenenkultur sind, sind abstrakte Repräsentationen von Landschaften, an die die Künstler Bindungen hatten. Es ist interessant, daß die Pintupimeister traditionell das Bild wegwischten, das sie in den Sand gezeichnet hatten, beinahe sobald es vollendet war. Sie behandelten jede sukzessive Zeichnung als Rahmen oder Episode in einer Geschichte. Die ganze Geschichte konnte nie auf einmal gesehen werden. Ein Teil der Geschichte lag immer verborgen, entweder in der Zukunft oder in der kürzlich ausgelöschten Vergangenheit. Diese Ontologie, wenn man so will, dieses Fundament des Wissens, wäre undenkbar ohne das Medium des Sandes.
(...)