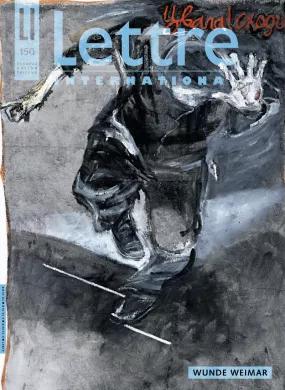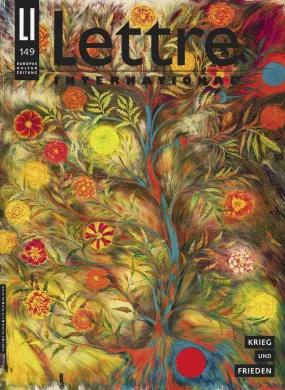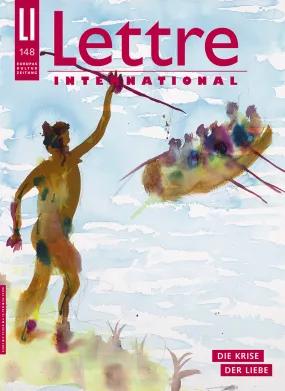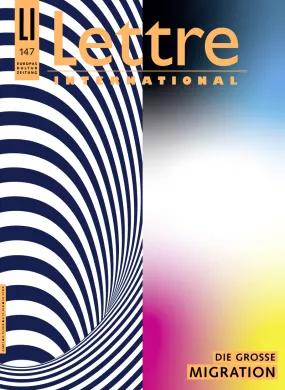LI 85, Sommer 2009
Warum wir Reisen
Über die bewegende Verschwörung von Wahrnehmung und PhantasieElementardaten
Genre: Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Englischen von Martin Pfeiffer
Textauszug
Wir reisen zunächst, um uns zu verlieren; und wir reisen dann, um uns zu finden. Wir reisen, um unsere Herzen und Augen zu öffnen und mehr über die Welt zu erfahren, als unsere Zeitungen fassen können. Wir reisen, um in unserer Unwissenheit und in unserem Wissen das Wenige, das uns zur Verfügung steht, in die Teile des Globus zu tragen, deren Reichtümer anders verteilt sind. Und wir reisen im wesentlichen, um wieder zu jungen Narren zu werden – um die Zeit zu verzögern und uns vereinnahmen zu lassen und uns noch einmal zu verlieben. Am besten hat die Schönheit dieses ganzen Prozesses, noch bevor die Menschen anfingen, häufig zu fliegen, vielleicht George Santayana in seinem lapidaren Essay Die Philosophie des Reisens beschrieben. „Manchmal“, schrieb der Harvard-Philosoph, „müssen wir in offene Einsamkeiten entfliehen, in Ziellosigkeit, in die moralischen Ferien, irgendein reines Risiko eingehen, um die Schneide des Lebens zu schärfen, um Strapazen zu kosten und uns dazu zwingen zu lassen, für einen Augenblick an etwas zu arbeiten, ganz gleich woran.“
Ich liebe diese Anspannung bei der Arbeit, denn nie wird uns mehr gezeigt, als wenn wir unterwegs sind, in welchem Maße unsere Segnungen der Schwierigkeit proportional sind, die ihnen vorangeht; und ich liebe die Anspannung bei einem Urlaub, die „moralisch“ ist, da wir in unsere ethischen Gewohnheiten ebenso leicht fallen wie am Abend in unser Bett. Nur wenige von uns vergessen je den Zusammenhang zwischen travel und travail, und ich weiß, daß ich, wenn ich reise, zu einem großen Teil auf der Suche nach Entbehrungen bin – sowohl nach meinen eigenen, die ich spüren will, als auch nach denen der anderen, die ich sehen muß. Reisen in diesem Sinne leitet uns zu einem besseren Gleichgewicht zwischen Weisheit und Mitgefühl an – dazu, die Welt klar zu sehen und sie doch wahrhaft zu fühlen. Denn Sehen ohne Fühlen kann selbstverständlich unsozial sein, während Fühlen ohne Sehen blind sein kann.
Die erste große Freude beim Reisen ist für mich jedoch einfach der Luxus, alle meine Überzeugungen und Gewißheiten zu Hause zu lassen und alle Dinge, die ich zu kennen glaubte, in einem anderen Licht und aus einem schiefen Blickwinkel zu sehen. In dieser Hinsicht kann selbst eine Filiale von Kentucky Fried Chicken (in Beijing) oder die Auf-führung einer verkratzten Kopie von Wilde Orchidee (auf den Champs-Élysées) sowohl etwas Ungewöhnliches als auch eine Offenbarung sein: In China zahlen die Leute schließlich einen ganzen Wochenlohn, um bei Colonel Sanders zu essen, und in Paris hält man Mickey Rourke für den größten Schauspieler seit Jerry Lewis.
Wenn ein mongolisches Restaurant in Evanston, Illinois, auf uns exotisch wirkt, dann folgt daraus nur, daß ein Mc-Donald’s in Ulan Bator einen ebenso exotischen Eindruck machen würde – oder zumindest ebensoweit entfernt wäre von allem, das man erwartet. Heutzutage ist es zwar Mode, einen Unterschied zwischen dem „Touristen“ und dem „Reisenden“ zu machen, aber der wahre Unterschied ist vielleicht der zwischen denjenigen, die ihre Überzeugungen zu Hause lassen, und denen, die das nicht tun: Unter denen, die das nicht tun, ist ein Tourist einfach jemand, der klagt: „Hier ist nichts so wie zu Hause“, während ein Reisender einer ist, der murrt: „Hier ist alles genauso wie in Kairo – oder in Cuzco oder Kathmandu.“ Es ist alles so ziemlich dasselbe.
Für uns andere jedoch beruht die souveräne Freiheit des Reisens darauf, daß es einen herumwirbelt und auf den Kopf stellt und alles umstülpt, was man für selbstverständlich gehalten hat. Wenn ein Diplom, wie der berühmte Satz lautet, ein Paß sein kann (für eine Reise durch harten Realismus), dann kann ein Paß ein Diplom sein (für einen Crashkurs in kulturellem Relativismus). Und die erste Lektion, die wir unterwegs, ob es uns gefällt oder nicht, lernen, ist die, wie provisorisch und provinziell die Dinge sind, die wir für universell halten. Wenn Sie beispielsweise nach Nordkorea fahren, dann haben Sie wirklich das Gefühl, als seien Sie auf einem anderen Planeten gelandet – und die Nordkoreaner haben zweifellos auch das Gefühl, daß bei ihnen ein Außerirdischer zu Besuch ist. (Oder aber sie nehmen einfach an, daß Sie ebenso wie sie jeden Morgen Anweisungen vom Zentralkomitee darüber erhalten, welche Kleidung sie tragen sollen und welchen Weg sie nehmen müssen, wenn sie zur Arbeit gehen, und daß Sie ebenso wie sie Lautsprecher im Schlafzimmer haben, aus denen jeden Morgen bei Tagesanbruch Propaganda ertönt, und daß Sie ebenso wie sie fest eingestellte Radios haben, mit denen man nur einen einzigen Kanal empfangen kann.)
Zum Teil reisen wir also einfach, um unsere Selbstgefälligkeiten dadurch zu erschüttern, daß wir all die moralischen und politischen Nöte, die Dilemmata auf Leben und Tod sehen, mit denen wir uns zu Hause nur selten auseinandersetzen müssen. Und wir reisen, um die Lücken zu füllen, welche die Schlagzeilen von morgen lassen: Wenn man beispielsweise die Straßen von Port-au-Prince entlangfährt, auf denen es fast kein Pflaster gibt und Frauen neben Bergen von Müll ihre Notdurft verrichten, dann erfahren die Vorstellungen vom Internet und von einer „Eine-Welt-Ordnung“ eine heilsame Revision. Reisen ist das beste Verfahren, über das wir verfügen, um die Menschlichkeit von Orten wiederzugewinnen und sie vor Abstraktion und Ideologie zu bewahren.
Und dabei werden wir auch selbst vor Abstraktion bewahrt und fangen an zu sehen, wie vieles wir an die Orte tragen können, die wir besuchen, und wie sehr wir zu einer Art Brieftaube – zu einem Anti-Federal-Express, wenn man so will – werden können, wenn wir das, was jede Kultur braucht, hin und her transportieren. Ich stelle fest, daß ich immer Poster von Michael Jordan nach Kyoto mitnehme und geflochtene Ikebanakörbe nach Kalifornien zurückbringe; nach Kuba reise ich unweigerlich mit einem Koffer voller Flaschen mit dem Schmerzmittel Tylenol und Seifenstücke, und ich komme zurück mit einem, der vollgestopft ist mit Salsakassetten und Hoffnungen und Briefen an längst verlorene Brüder.
(...)