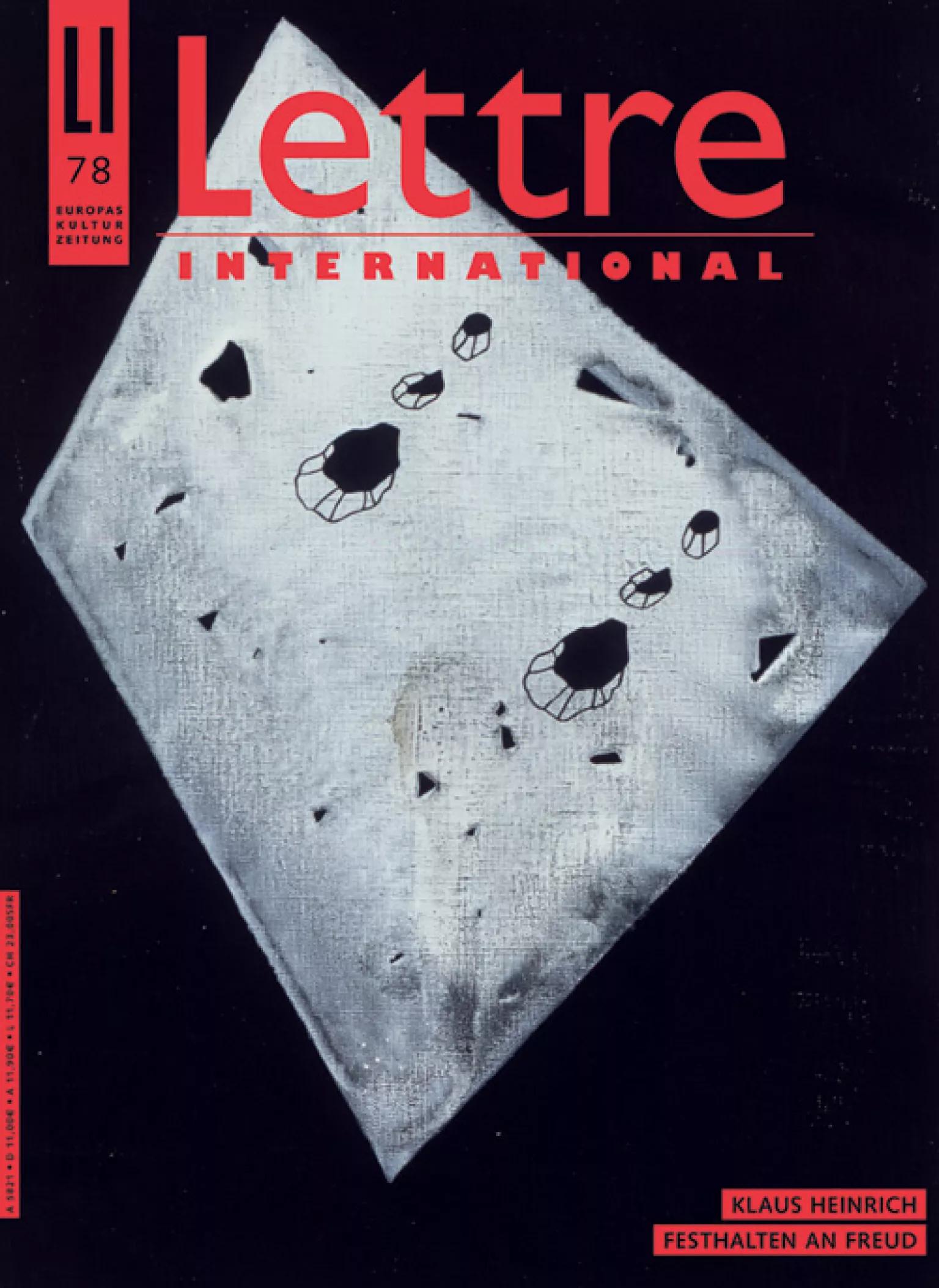LI 78, Herbst 2007
Unerhörtes Hören
Über Krach und Musik, Klang und Komposition, Spannung und HarmonieElementardaten
Textauszug
Axel Brüggemann: Botschaften werden über das Ohr überbracht, aber es ist gleichzeitig auch Körpereingang für viele andere Dinge. Marias Empfängnis ist ein Beispiel. Sie soll durch das Ohr stattgefunden haben. Hamlets schlafendem Vater wurde Gift ins Ohr geträufelt …
Wolfgang Rihm: Es sind Botschaften durch das Ohr, die Seelen vergiften. Deshalb sind die tauben Engel auch reine Wesen: Sie sondern nur ab, nehmen aber nichts auf. Andererseits ist das mit der Botschaft so eine Sache. Was wäre die Botschaft der Musik außer der Musik selbst? Meist ist sie ja nur ein Impuls, und die Botschaft setzt sich erst im Hörer zusammen, der diesem Zusammengesetzten dann den Namen Botschaft gibt. Denn Hören ist ja nicht nur das Hören, sondern auch das Voraushören und das erinnernde Hören.
Es bleiben ja auch nicht alle Botschaften in uns. Nicht umsonst gibt es die Redensart, daß etwas in das eine Ohr hinein- und durch das andere hinausgeht.
Deshalb liegt der Kopf zwischen den Ohren. Das Gehirn macht das Ohr zu einem Teil von uns. Wir vergessen zu oft, daß das Ohr nichts Fremdes ist, das uns kennt, sondern daß wir die Eigner der Ohren sind. Die Ohren sind unserer Kenntnis als Reizempfänger vorangestellt, aber sie können von sich aus keine Kenntnis in uns herstellen. Das Hören ist ein zutiefst selektiver Vorgang. An diesem Punkt wird es auch wichtig, zwischen Wahrnehmung und Hören zu unterscheiden. Wenn ich Popmusik höre, nehme ich nichts wahr – alles klingt für mich gleich, weil ich keine Schulung habe, weil ich mich nicht eingehört habe. Für das Wahrnehmen muß man die Differenzen wahrnehmen können. Ich höre etwas, aber ich merke zugleich, daß ich die Kriterien nicht finden kann, nach denen ich die Angebotsfülle der Klänge nutzen kann. Das ist wie eine Fremdsprache. Das Hören braucht Schulung – und die findet im Kopf statt.
Aber auch wenn wir das Gehörte nicht entschlüsseln können, wir nehmen es wahr und können es imitieren.
Nein, ich könnte einen Popsong höchstens karikieren. Das ist wie bei Leuten, die einer lateinischen Messe beiwohnen und nachher nur „Hokuspokus“ rufen, weil ihnen Hoc est enim corpus meus so klingt. Ich bezeichne in diesem Moment der Pseudoimitation nicht mehr die Sache an sich, sondern etwas Fremdes, dem ich aus Unbildung nicht nahekommen kann. Genauso wäre es in meinem Fall mit der Popmusik.
Das würde aber bedeuten, daß Hören hauptsächlich ein logischer Prozeß ist. Wo bleibt denn da die Sinnlichkeit, die Unmittelbarkeit der Kunst?
Natürlich spielt sie eine große Rolle, aber auch die Sinnlichkeit will entwickelt werden. Wenn ein Kind den Finger in ein Glas Wein tunkt und ihn ableckt, schmeckt das fürchterlich. Es ist ein Lernprozeß nötig, um guten Wein genießen zu können. Das gilt auch für die Gefühle. Die sind ja nicht einfach da, sondern werden gehegt und ausgebildet.
Trotzdem gibt es Musik, die kollektiv als schön empfunden wird, die ganz direkt und ohne Umwege den Zuhörer trifft. Weiß ein Komponist, welche technischen Mittel möglich sind, um durch das Hören allgemeine Instinkte zu berühren?
Neben den gelernten Strukturen ist die Musik natürlich auch auf rudimentäre Situationen angewiesen, auf atavistische Regungen, die in uns anwesend sind. Ein Hören, dem wir ausgesetzt sind. Es ist nicht nur für Musiker wichtig, sich dieser Mechanismen bewußt zu sein, denn wenn wir so tun, als gäbe es sie nicht, können wir mit diesen Gefühlen auch nicht umgehen. Wir müssen wissen, daß es akustische Effekte gibt, die uns direkt treffen, um nicht denjenigen auf den Leim zu gehen, die nur mit diesen Effekten an unsere Affekte appellieren. Aber letztlich entsteht das „Genommenwerden“ von Kunst nicht durch einen Effekt, sondern durch die Vielfalt, in der subtilen Abstufung von Möglichkeiten.
Für die meisten emotionalen Reaktionen auf das Hören bedarf es außerdem eines kulturellen Vorentscheids. Der Musikwissenschaftler Hans Heinrich Eggebrecht sprach davon: Man hatte einem afrikanischen Stamm den Trauermarsch aus Beethovens Eroica vorgespielt. Und dort nahm man diese Musik als lustig wahr. Das zeigt: Man braucht die kulturelle Übereinkunft, daß das, was wir gerade hören, „pathetisch“ sei. Es muß irgendwann als solches beschriftet worden sein: „Vorsicht, Pathos!“ Oder: „Endlich! Pathos!“ Ohne dieses Korsett scheint die Musik nicht zu funktionieren. Den Hörer, der von nichts weiß, der völlig unvorbereitet ist, gibt es nicht. Der Hörer, der unser Wunsch als Musiker ist, der offen und rein kommt, um zuzuhören, was wir ihm sagen, ist eine schöne Vision. Hörer sind immer vorbereitet. Manchmal aber nicht auf das Gehörte.
Eggebrecht hat Sie einmal gebeten, in einem Satz zu sagen, was Musik ist. Sie haben ihm geantwortet: „Musik ist Freiheit, auf die Zeit gesetzte Klangzeichenschrift, die Spur undenkbarer Gestaltfülle, Färbung und Formung von Zeit, sinnlicher Ausdruck von Energie, Abbild und Bann vom Leben, auch Gegenbild, Gegenentwurf – das Andere.“
Das ist wahrscheinlich genauso hilflos wie all die anderen Versuche, der Musik in Worten beizukommen. Was würde ich heute antworten? Vielleicht: „Musik ist die Antwort, die uns die Frage bewußtmacht.“
An anderer Stelle haben sie die Musik als „inneres Ausland“ beschrieben. Welche Rolle spielt das Andere, das Fremde beim Hören?
Es gibt eine Kategorie des anderen, auf die sich alle einigen können – die meine ich nicht. Ich rede nicht von der Partei der anderen, denn jeder andere ist ein anderer. Ich rede nicht von der Gestalt des anderen, wie wir sie als Konvention übernommen haben, sondern von dem Anderen, das all das seinerseits negiert. Ich nehme mal ein Beispiel aus meiner Biographie, hoffentlich ohne dadurch zu falscher Mythenbildung anzuregen. Das Skandalon, als ich zum ersten Mal in Donaueschingen aufgeführt wurde, war nicht, daß da wieder einmal neue Musik in der Neuen Musik zu hören war, sondern, daß Gestalten, die vertraut schienen, nur durch Verrückungen etwas offensichtlich Neues hörbar gemacht haben. Wichtig ist: Das war kein bewußter Prozeß – ich konnte und wußte es gar nicht anders aufzuschreiben.
(...)