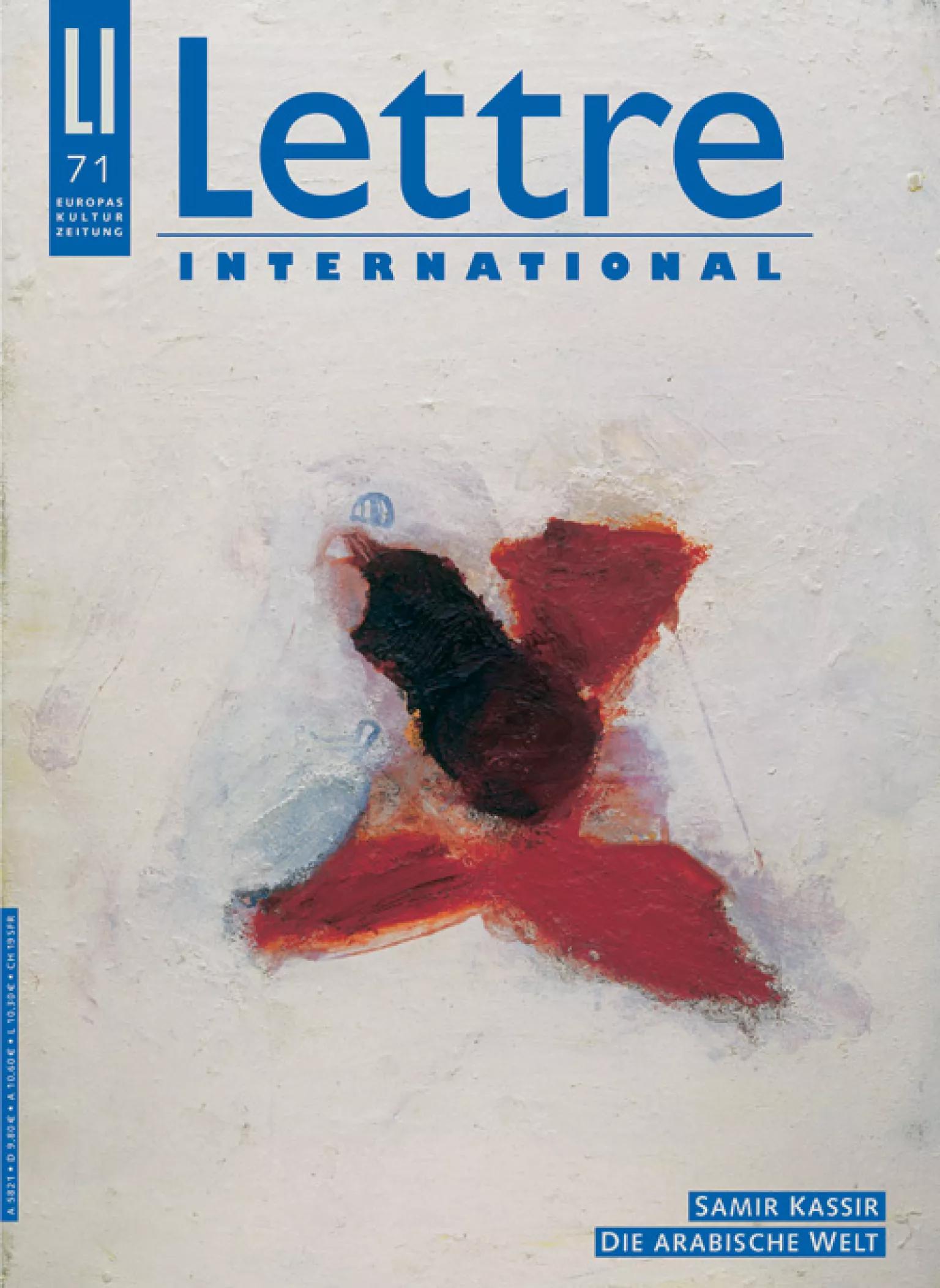LI 71, Winter 2005
In der Rub al-Khali
Beduinenkultur oder vom Elend der Bücher im Leeren ViertelElementardaten
Textauszug
„Der Beduine begnügt sich mit der Befriedigung seiner Bedürfnisse. Der Seßhafte sucht Komfort und Luxus.“
Ibn Chaldun
Der Süden der Arabischen Halbinsel gehört zu den lebensfeindlichsten Regionen der Erde. Seine wüstenartigen Küsten grenzen im Westen an das Rote Meer, im Süden an das Arabische Meer, im Südosten an den Golf von Oman und im Osten an den Arabisch-Persischen Golf. In seiner Mitte liegt das größte wasserlose Wüstengebiet der Erde, Rub al-Khali, das sogenannte „Leere Viertel“.
Beim Anflug auf den internationalen Flughafen von Maskat, der Hauptstadt von Oman, sieht man es im Dunst hinter den wie von einer geschickten Maniküre zurechtgefeilten Bergspitzen des Hadschargebirges mit seinen weiß leuchtenden Schotterebenen, die von breiten wasserlosen Wadis durchzogen sind. Dahinter erstreckt sich die für Mensch und Tier gefährliche Salzsenke Umm al-Samim.
Doch statt auf schwankendem Kamelrücken in wochenlangen ermüdenden Märschen nähert sich der Reisende dieser legendären Wüste heute im komfortablen, gekühlten PKW über eine kreuzungsfreie Autobahn. Entlang gepflegter Oasenstädtchen mit akkurat restaurierten Burgen, Wehrtürmen und Stadtmauern in mustergültigen Palmenhainen gelangt man bis zum Zusammentreffen der großen Wüstenstraßen bei Firq, die nach Norden in Richtung Vereinigte Emirate und nach Westen in Richtung Dhofar führen. Diese Allerweltskreuzung mit Tankstelle, Supermarkt und Motel hat das ehemalige Tor zur Rub al-Khali, die Oasenstadt Adam mit ihren in mächtigen Lehmmauern versteckten Wohnhäusern, abgelöst. Schon die Offenheit der Raststätte im Vergleich zu der vor räuberischen Beduinenstämmen geschützten Festung demonstriert die beeindruckenden gesellschaftlichen Veränderungen in diesem Teil Arabiens.
Die Landschaft wird topfeben. Die Salzbüsche, Grundnahrung der Kamele, wachsen immer spärlicher, dann verschwinden sie vollständig.
Die aus den siebziger Jahren stammende zweispurige Fahrstraße wird ständig gewartet und an besonders gefährlichen Stellen immer wieder neu angelegt. In der Ferne bilden viele Bohrtürme, Strommasten oder GPS-Stationen die einzigen vertikalen Sichtachsen. Ab und an weist ein Schild in arabischer Schrift auf Bauarbeitercamps, Tankstellen mit beigeordneten Moscheen, Picknickpavillons, Wanderdünen, kreuzende Wildkamele oder mögliche Überschwemmungsgefahr in einem Wadi hin. Ihr regelmäßiges Auftauchen vermittelt den Eindruck von Umsorgtheit, Sicherheit und Kontrolle. Hier wird niemand seinem Schicksal überlassen, signalisieren sie. Ständig spazieren einzelne Personen oder Grüppchen entlang des Asphaltstreifens am Rande des „Leeren Viertels“. Sie vermessen, sammeln Müll auf, bessern den Straßenrand aus, beseitigen Sandanhäufungen oder vertreten sich in kilometerlangen Märschen die Beine nach einem rituellen Gebet am Straßenrand. Der nicht sehr starke Verkehr aus Lastwagen, Bussen, Militärkonvois, Pick-ups und Personenwagen reißt jedoch nie ab. Die Wüste, die am Fenster vorbeizieht, wirkt dadurch noch unrealistischer, weniger kahl und weit. Es hat den Anschein, als könnte sie mit ihrer sonstigen vernichtenden Gewalt gerade diesen kleinen schmalen Streifen zivilisatorischen Glücks nicht erreichen.
Auf 1 300 Kilometern bilden drei kleine festungsartige Rasthäuser die eigentlichen Höhepunkte dieser Wüstenfahrt. Ihr Vorbild sind die ehemaligen Karawansereien, gesicherte Übernachtungshöfe für Tiere, Menschen und Waren. Auch heute noch sind die staatlichen Rasthäuser von Ghaba, Ghaftain und Qatbeet von Mauern umgeben. Aber sie müssen keine feindlichen Angriffe raublustiger Beduinen abhalten, sondern sie sollen bloß der unaufhörlichen Zersetzungskraft des Sandes einen kleinen Widerstand entgegenstellen.
Im Inneren der Mauern versuchen Akazien und Palmen tapfer gegen Hitze, Staub und Wassernot anzukämpfen, um wenigstens den Eindruck einer schattigen Oase zu erwecken. Das Rasthaus wirkt mit seinen fensterlosen Wänden und einer schweren Eingangstür wie eine Trutzburg. Die Zimmer jedoch bieten jede Art von modernem Komfort: fließendes kaltes und warmes Wasser, Satellitenfernsehen, Klimaanlage und Heizung. Nur der Becher milchig-süßen Tees, den der indische Diener im Innenhof unter den Oleanderbüschen serviert, erinnert in seiner luxuriösen Einfachheit an den allgegenwärtigen Mangel, den das Leben ehemals in der Wüste bedeutete. Hunger und Durst, die ständigen Begleiter der Beduinen und anderer Reisender, zeichneten das Lebensgefühl in diesen sandigen Weiten aus.
Zwischen dem Rasthaus und der Tankstelle befindet sich ein kleines Ladengeschäft mit einer riesigen vielversprechenden Aufschrift: „Foodstuff & Luxuries“, Nahrungsmittel und Luxuswaren. In seinem Inneren kann man fast alles erwerben, was die Einheimischen für „notwendig & begehrenswert“ halten. Zur ersten Kategorie gehören unter anderem in Plastikflaschen abgepacktes Trinkwasser, Speiseöl, Reis, Brot, Zucker, Salz, Fischkonserven und getrocknete Datteln. Daneben stehen auf staubigen Regalbrettern die Luxusartikel: Kaffee, Parfümflakons in bauchiger oder schlanker Form mit türkisfarbenem, rosa oder amberfarbenem Inhalt, Weihrauch in Klumpen und Splittern, Kolliers und Armbänder, Ohrringe und Broschen aus Gold, Silber oder Billigmetall, belegt mit wertvollen Steinen oder Glasperlen, bunte Nippesfiguren und, als Höhepunkt des Angebots, Schokoladenzuckerzeug gegen den „kleinen Hunger“ und internationale Limonaden gegen den „großen Durst“. Manchmal findet man zwischen all diesen mundwässernden Verlockungen auch Billiguhren, ein Transistorradio, ein paar veraltete Action-Videos oder Musikkassetten. Was es jedoch hier nicht zu kaufen gibt, sind Druckerzeugnisse, weder Zeitschriften noch Schulbücher noch Unterhaltungsliteratur. Nur ein Werk stellt auch hier die Ausnahme zur Regel dar. Man findet in diesen „Ali-Baba-Höhlen des glücklichen Konsums“ einige abgegriffene Koran-Ausgaben, als Kurzversion zum Reisen oder als integralen Text für zu Hause.
Nach Ansicht der allermeisten Omani, gleichgültig ob sie des Lesens und Schreibens kundig oder Analphabeten sind, ist der Besitz dieses einen Buches völlig ausreichend. Denn so steht es bereits in „Surat Ya-Sin“, der „Sure vom Offensichtlichen“, geschrieben: „… und von allem berichten wir in einem einzigen, alles erklärenden Buch“. Es sei dahingestellt, ob diese jahrhundertealte Einsicht ins „Offensichtliche“ bei den Beduinen der südlichen arabischen Halbinsel durch massiven Druck oder Überzeugung hervorgerufen wurde. Denn die Herrscher über das damalige Territorium Ghubaira, dem heutigen Oman, die Brüder Jaufar und Abd al-Julandi, erhielten im Jahr 630 einen Brief von einem bis dahin eher unbekannten Kaufmann, Abu al-Kasim, genannt Mohammed. Er forderte in vorweggenommenem Größenwahn die Herrscher von Byzanz, Äthiopien, Persien, Ägypten, Jemen und eben auch des kleinen Oman auf, sich zur „neuen Religion aller Gläubigen“ zu bekehren. „Wenn Ihr Euch zum Islam bekehrt, werde ich Euch dazu ermächtigen, zu herrschen, und wenn nicht, wird Eure Herrschaft vorbei sein, und meine Pferde werden Eure Gebiete überrennen, und meine Prophezeiung wird wahr werden.“ Ohne das Ergebnis der Drohung abzuwarten, bekehrten sich die Brüder zum Islam, und mit ihnen ihre Untertanen. Doch schnell entschieden sie sich, der neuen Glaubenslehre ein eigenes Gesicht zu geben. Sie wurden zu Anhängern des in Basra predigenden Ibn Ibad, der die Auffassung vertrat, daß jeder gläubige Muslim, der eine religiöse Ausbildung genossen habe, zum weltlichen und religiösen Oberhaupt gewählt werden könne, und nicht nur die nahen oder fernen Verwandten des Propheten.
(…)