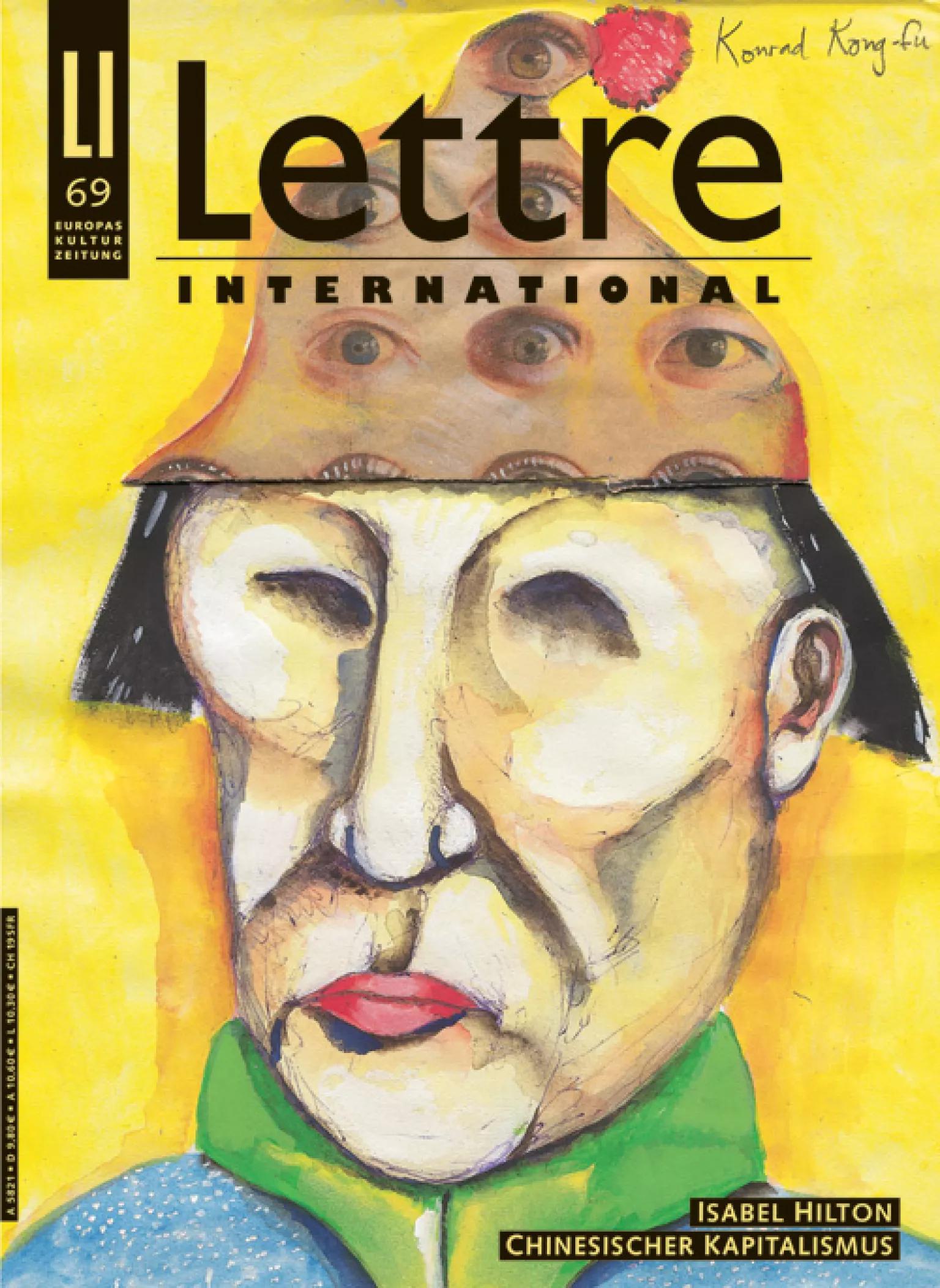LI 69, Sommer 2005
Made in China
Die Arbeiter von Guangdong in der globalen ProduktionsschlachtElementardaten
Genre: Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Englischen von Marcus Ingendaay
Textauszug
(…) Die Fabrik lag in einem kleinen Dorf namens Bailijun im Bezirk Pingfu. Der Besitzer, ein Hongkong-Chinese, war bereits seit 1984 dort, trotzdem machte alles noch einen provisorischen Eindruck. 200 Arbeiter produzierten unter seiner Regie Billigschmuck für den internationalen Massenmarkt. Zwar gab es örtliche Arbeitsschutzrichtlinien, aber darum scherte sich niemand. Der Firmenchef hielt sich oft selbst in der Werkhalle auf. „Damals hatte er nicht mal ein Auto“, sagte Wu. „Doch 1993 hatte er plötzlich vier, eines davon ein Mercedes.“
Wu verdiente hundert Yuan im Monat, wovon er sechzig zum Leben brauchte. Erst hatte er nur vorgehabt, ein paar Jahre lang Geld zu verdienen, um dann in sein Dorf zurückzukehren, aber er gewöhnte sich an das Leben in der Stadt. 1992 kam seine Frau nach. In den ersten zwei Jahren wohnten sie getrennt, jeder in einem überfüllten Schlafsaal mit acht bis zehn anderen Arbeitern, bevor die Fabrik ihnen erlaubte zusammenzuziehen. Ihre beiden Kinder hatten sie in der Obhut von Wus Eltern zurückgelassen. Sie sahen sie alle paar Jahre, wenn sie genügend Geld und Urlaubstage für die weite Reise angesammelt hatten. Zwischenzeitlich schrieben sie ihnen. Ein Brief brauchte einen Monat.
Gleichwohl war Wu nicht unzufrieden. Zwölf Stunden saß er an einer Schleifmaschine und bearbeitete Halbedelsteine. In der Nebensaison hatte er zwei freie Tage im Monat, in der Hauptsaison nur einen, wenn überhaupt. Wu empfand das nicht als übertriebene Belastung. Er war jung, und jeder, der auf dem Land groß geworden war, war harte Arbeit gewöhnt. Was zählte, war, wieviel er der Familie am Monatsende schicken konnte. Als dann das Werk erweitert wurde, machten sich immer mehr Mitglieder seiner verzweigten Familie auf die Reise nach Shenzhen. Zuletzt arbeiteten fünfzig Cousins, Cousinen, Onkel, Brüder und Schwäger für Lucky Gem. In den zehn Jahren, in denen er dort angestellt war, schwoll die Belegschaft auf über tausend Arbeiter an. 1997 wurde das Werk nach Huizhou verlagert, da Shenzhen zu teuer geworden war.
Während Herr Wu erzählte, fuhren wir weiter zu anderen ehemaligen Arbeitern von Lucky Gem. Wir bogen von der Hauptstraße ab und fuhren auf einer Schotterpiste, die in einem Labyrinth aus kleinen Sträßchen, geborstenem Asphalt und mehr oder weniger planlos hingesetzten Behausungen endete. Einige davon hatten weiß gekalkte Wände und rote Ziegeldächer, Zeugnisse einer früheren unschuldigeren Landschaft, die nun mit hastig errichteten Betonbaracken um Raum kämpfen mußten, die Bauern errichtet hatten, um schnelles Geld zu machen. In einer dieser Baracken, einem fünfgeschossigen Bau mit einem am Sockel verlaufenden offenen Abwasserkanal, lebte Herr Wu. Seine Frau war zurück nach Sichuan gezogen.
Wir stiegen die nackte Betontreppe hinauf, folgten einem dunklen Betonkorridor und standen schließlich in einem großen Raum mit einem Bett, einem Tisch und zwei Plastikhockern in Kindergröße. Herr Wu saß auf dem Fußboden, an die Wand gelehnt, den Kopf nach hinten geneigt, damit die langen Haare nicht seine Augen verdeckten. Ich ließ mich auf einem Hocker nieder. Von einem Kleiderbügel, der an einem Nagel in der Wand hing, baumelte ein kleiner Plastikspiegel. Ein Elektrokabel verlief an der Decke bis zu einer Neonröhre. Die mit Insektengittern versehenen offenen Fenster ließen frische Luft ein, aber der Raum war feucht und stickig. Die beiden kleinen Ventilatoren wälzten diese Stickluft nur um. Auf dem Tisch lag ein Päckchen Spielkarten, die Ränder schwarz vom Gebrauch.
Andere Arbeiter blieben an der Tür stehen und starrten mich an, während Wus Freunde eintrafen, die Flip-Flops im Flur abstreiften und sich auf den Boden oder auf das Bett setzten, um ihre Geschichte zu erzählen. Ein dünnes Blatt Papier machte die Runde. Darauf notierten sie ihren Namen und ihr Herkunftsdorf. Alle waren Bauern aus Sichuan. Alle waren verheiratet, alle hatten Kinder, und sie alle sahen einem frühen Tod entgegen.
Keiner der Männer in Wus Zimmer arbeitete noch für Lucky Gem. Herr Wu zeigte auf einen kleinen Mann, der sich still an die Wand gesetzt hatte, die Beine vor sich ausgestreckt. Sein Gesicht war bleich. Liu Huaquan, so Wu, war der erste, der krank geworden war. Liu nahm es mit einem Lächeln zur Kenntnis, wohl aus einem eigenartigen Stolz über den Spitzenplatz. Die ersten Symptome, Atemnot und Husten, machten sich 1999 bemerkbar. Die Ärzte diagnostizierten eine Tuberkulose, und zweieinhalb Jahre lang zahlte er 300 Yuan monatlich für die Behandlung. Doch sein Zustand verschlechterte sich zusehends, und als er im Zentrum für Berufskrankheiten in Guangzhou ein zweites Gutachten einholte, hieß es, er habe Silikose.
„Von so etwas hatte ich noch nie gehört“, sagte Liu. „Sie sagten, es sei eindeutig berufsbedingt und ich solle aufhören zu arbeiten. Sie sagten auch, ich solle von der Fabrik Schadenersatz verlangen. Ich wollte aber lieber arbeiten. Ich will es immer noch. Ich habe eine Frau und zwei Kinder. Aber inzwischen verlangt man überall ein Gesundheitszeugnis, und ich kriege keine Stelle mehr.“ Sein Gewicht hatte sich von 60,5 Kilo auf 45 Kilo verringert, und er schaffte es kaum die Treppe hoch. Silikose ist unheilbar, aber mit der richtigen Behandlung läßt sich ihr Verlauf verzögern. Liu hatte eine Einmalzahlung aus irgendeinem Sozialfonds erhalten, wollte aber das Geld nicht für eine lebensverlängernde Therapie ausgeben, da er befürchtete, für seine Frau und seine Kinder bliebe dann nichts mehr übrig. Seine einzige Hoffnung bestand darin, die Fabrik irgendwie zu einer Entschädigung zu zwingen. „Daß so etwas geschehen könnte, wäre mir im Traum nicht eingefallen“, sagte er. „Ich dachte, ich arbeite da eine Zeitlang, kehre irgendwann in die Heimat zurück und mache mich selbständig.“
Einer der Männer war auf Wus Bett eingeschlafen und schnarchte.
Silikose: Arbeiter im Steinbruch bekommen sie, Bergleute bekommen sie. (Auch wenn in England nur noch wenige Zechen in Betrieb sind, ist das Entschädigungsprogramm für ehemalige Bergleute eines der größten der Welt.) Die Krankheit führt zu Entzündungen und Gewebeveränderungen in der Lunge durch das Einatmen von quarzhaltigem Staub, jener Art von Staub, die an den Schleif- und Poliermaschinen bei Lucky Gem anfiel. Nach Lius Befund wurde den anderen nach und nach klar, daß auch sie krank waren. Alle ließen sie sich im Zentrum für Berufskrankheiten untersuchen, und alle erhielten sie ihr Todesurteil ausgehändigt. Insgesamt wurde bei 45 Arbeitern von Lucky Gem Silikose diagnostiziert.
(…)