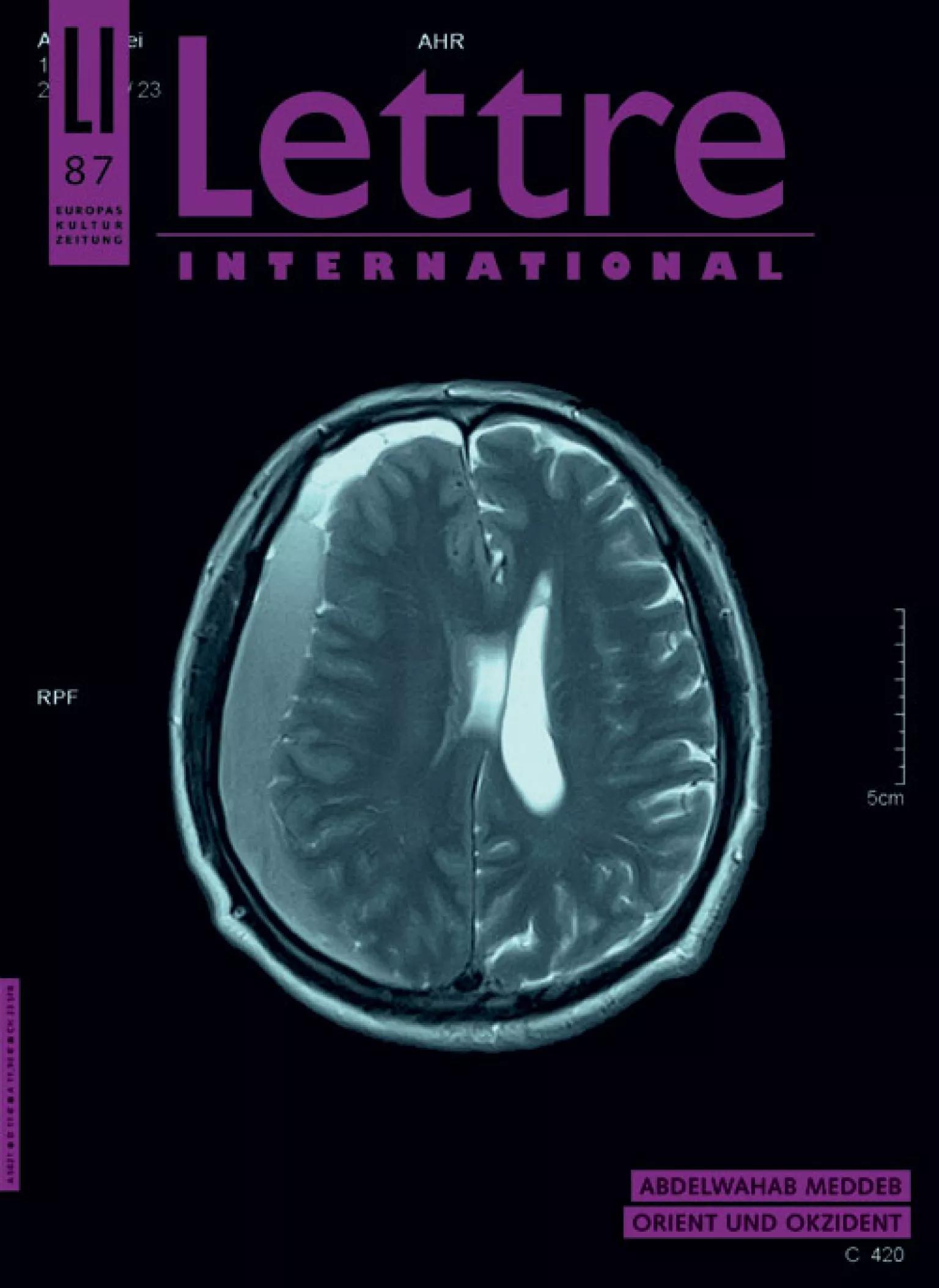LI 87, Winter 2009
Tage in Afghanistan
Begegnungen in einem Land der Ehre und des Krieges. Ein ReisetagebuchElementardaten
Genre: Reportage, Tagebuch
Übersetzung: Aus dem Portugiesischen von Inés Koebel
Textauszug
KABUL, 1. JUNI 2008
„Weißt du, wer in dem Haus dort gewohnt hat?“ fragt Peter und deutet aus meinem Fenster in der Kabul Lodge. Er grinst.
„Jemand Berühmtes, keiner kriegt ihn zu fassen.“
Haider, der Eigentümer der Kabul Lodge, hat es ihm erzählt. Osama Bin Laden lebte dort, und hier war der Sitz der Taliban. Peter geht in den Flur vor den Zimmern und zeigt auf einige Fenster.
„Da, Farbreste. Man hat sie zugemalt, damit keiner sehen konnte, was drinnen vor sich ging.“
Er zeigt mir auch eine kleine Treppe im Garten.
„Da unten, im Keller, da hatten sie ein Gefängnis. Und zwar noch bevor Bin Laden nach Kandahar ging, um den 11. September in die Wege zu leiten.“
Er soll immer in einem Konvoi von zehn schwarzen Wagen gefahren sein, alle unterschiedlich und alle gleich.
Die Leute hier sagen, eine Ausländerin geht nicht allein auf die Straße. Zum einen, weil afghanische Frauen nicht allein auf die Straße gehen. Zum anderen, weil Ausländer häufig Ziel von Entführungen sind. Deshalb sind Ausländer meist in Autos unterwegs. Die Firmen und Unternehmen haben durchweg Wagen mit Fahrern, die an die Ziegenpfade gewöhnt sind, auf denen sich ein Großteil des Verkehrs von Kabul staut.
Von außen sieht man nichts, aber alle wissen es. Dies ist das Eingangstor der Aga-Khan-Stiftung. Dahinter tiefgrüne Gärten mit hochgewachsenen seidigen Rosen, die ihren Duft verströmen, und ein großes, wunderbar renoviertes altes Haus.
Jolyon Leslie, Architekt, Südafrikaner und seit 1989 in Kabul, ist der Direktor des Aga Khan Trust for Culture (AKTC), der die alten Stadtviertel von Kabul und Herat unter Einbeziehung der Bevölkerung saniert. Er hat jahrelang für die UNO gearbeitet, ehe er wegen der Sanktionen gegen den Irak ausgeschieden ist. General McNeill, der demnächst das Kommando über die ISAF-Truppe abgibt, sagte während eines Abendessens zu ihm, er höre zuviel auf die Taliban, woraufhin Jolyon ihm erklärte, die Afghanen seien mit der ISAF unzufrieden.
Jolyon meint, die ISAF sei „ein Fiasko in Sachen Öffentlichkeitsarbeit“. Die Afghanen „haben zunehmend Vorbehalte“, sie lehnen die ISAF ab. Die Taliban waren schrecklich, aber manches an ihnen war so schrecklich wieder nicht. Viele Ausländer und zurückgekehrte Afghanen machen, um den Kampf gegen den Terrorismus zu rechtfertigen, die Situation schlimmer, als sie ist. Ausländer, NGOs und Wirtschaftsinteressen.
Die Ausländer, die ihre Bunker vor lauter Angst nicht verlassen und nichts mitbekommen hinter den getönten Scheiben ihrer 4 x 4-Jeeps. Jolyon laden sie als exotic independent zu ihren Abendessen ein.
Die Afghanen enttäuschen nicht gern. Deshalb sagen sie ja, auch wenn sie uns nicht verstehen. Nein sagt man nicht, es gehört sich sowenig, wie sich die Nase zu putzen oder die Fußsohlen zu zeigen. In der Kabul Lodge sind Steuern, Erfrischungsgetränke und Bin Laden, der Mythos aller Mythen, im Zimmerpreis inbegriffen.
Die Afghanen pflegen ihre Geschichte wie ihre Rosen. Auf der Straße zur Kabul Lodge, die voller Schlaglöcher, schlammiger Pfützen und Steine ist, gehen barfüßige Frauen in Burkas. Neben dem Eingangstor befindet sich ein verrostetes Schutzdach mit einem Wächter. Das Tor ist ein Witz. Aber dann geht es auf, und ein Weg führt zum Haus, das ganz auf den Garten ausgerichtet ist. Im Garten gibt es Rasen, er wird täglich gestutzt und gesprengt, zudem schlanke, blutrote Rosen, die ihre Köpfe so hoch tragen wie die alten Männer mit ihren Turbanen und graumelierten Bärten und wie der Gärtner dieses Hauses. Die Straße ist voller Löcher, und die Badezimmer sind Löcher, aber die Rosen in Afghanistan sind eine Geschichte für sich, hochgewachsen und nicht kleinzukriegen von der Junihitze – von Staub, Höhe und Kohlenmonoxid.
2. JUNI
Letzte Pressekonferenz von General McNeill, Kommandeur der ISAF.
Da es sich um einen Abschied handelt, dachte ich, jede Menge „eingebetteter Journalisten“ seien zugegen, aber viele Stühle sind leer. Zum Schluß kommt doch noch Bewegung in die Runde, durch afghanische Journalisten.
„Warum begleiten Sie keine Patrouillen?“ will General McNeill wissen.
Ja, warum nicht? Weil sie dann ihren Job oder ihr Leben verlieren. Die afghanischen Journalisten, die weder Schutz genießen noch vorbereitet sind, werden mit Kriegsherren konfrontiert, korrupten Poli-zisten, religiösen Fanatikern, Regierungsinteressen und der ISAF-Strategie. Und das ist tödlich.
Während General McNeill sein Bedauern über seinen Abschied kundtut, fließt Wasser aus der Klimaanlage.
3. JUNI
Ein großes Tor mit Stacheldraht an einer Straße voller Schlaglöcher. Neue Einrichtungen in einem Gebäude, das früher ein Gefängnis war, und in einem weitläufigen, nahezu leeren Büro der junge Tarek. Ein Mann in den besten Jahren, strahlende Augen, Adlerprofil. Er könnte auf einem Pferd daherkommen und wie Dschingis Khan alles dem Erdboden gleichmachen.
Einer seiner Cousins serviert uns allerbesten Tee, mit Milch, Zucker und Kardamom. Ich könnte immer weiter trinken. Tarek zeigt mir Photos von Boxerinnen. Er fragt mich, ob ich das Nachtleben von Kabul kenne und ob ich heute abend schon etwas vorhätte.
Zunächst aber erzählt er mir sein Leben, nicht ohne vorher mit der ISAF ins Gericht zu gehen.
„Wenn sie sagen, sie haben 16 Taliban getötet, dann haben sie zwei Bauern umgebracht, drei Frauen und fünf Kinder …“
Tarek steckt voll neuer Ideen für Afghanistan.
„Ich versuche, die Wirtschaft von Afghanistan unter Berücksichtigung seiner Industrie, seiner Geschichte und seiner Landwirtschaft aufzubauen. Andernfalls werden wir zu Sklaven der Welt. Ich habe mich ein Leben lang auf die Rückkehr in mein Land vorbereitet. Die ganze Zeit hieß es nur: ,Dein Großvater war dies, dein Großvater war das.‘ Mein Großvater war Schawali Khan, der erste Kommandant des afghanischen Jagdgeschwaders. Und der Leibwächter von König Sahir Schah. Als die Kommunisten die Macht übernahmen, kamen die Leute zu meinem Großvater in sein Haus in Dschalalabad, um ihn zu warnen: ,Schawali, bring dich in Sicherheit.‘ Aber er wollte nicht fliehen und in einem anderen Land Sklave sein. Den Kommunisten erklärte er: ,Ich habe meinen Eid auf Sahir Schah geleistet.‘ Sie haben ihn ins Gefängnis gesteckt. Alle wissen, daß er hätte fliehen können, aber er hat es nicht getan. Eines Tages werde ich ein Held sein, genau wie mein Großvater.“
Tareks Großvater mütterlicherseits.
„Mein Großvater väterlicherseits war ein großer Stammesführer in Nuristan. Sein Vater, Schal Pascha, hat die heidnischen Stämme Nuristans islamisiert.“
Diese gebirgige Provinz im Nordosten Afghanistans ist sagenumwoben. Obgleich von Muslimen umgeben, blieb sie bis Ende des 19. Jahrhunderts heidnisch. Somit ist Tarek also der Urenkel des Mannes, der diese Stämme zwangsbekehrt hat. Er besitzt zwar das gleiche markante Profil wie diese Paschas und Khans und trinkt Tee mit Kardamom, spricht aber mit kalifornischem Akzent.
„Ich kann Geschäfte über 10 Millionen Dollar tätigen. Deswegen bewege ich mich aber noch lange nicht mit einer bewaffneten Eskorte durch die Gegend wie alle, die es sich leisten können.“
Tarek sagt, er möchte für sein Land leben, angefangen bei der Afghanin, mit der er verlobt ist und Kinder haben wird.
„Ehre und Stolz ist alles, was wir haben. Die ausländischen Truppen treten uns mit Füßen, sie versuchen uns fertigzumachen, aber wir Afghanen geben nicht klein bei. Kabul ist nicht Afghanistan, Kabul ist die Gosse von Afghanistan.“
Kabul als Symbol der zentralen Macht, das gibt es nicht in der Stammestradition.
Tarek blickt nach vorn wie ein professioneller Kämpfer. Diese Nase hat er nicht nur von seinen Vorfahren, sondern auch von den Faustschlägen im Ring. Der Mann ist ein Boxer, und jetzt ist er hier, um zu gewinnen.
„2004, als ich zurückkehrte, war ich ziemlich aggressiv. Bei uns zählt die Ehre, und man hat es meiner Familie gegenüber an Achtung fehlen lassen. Ich bin ein Kämpfer, und ich bin gekommen, um die Dinge wieder zurechtzurücken. Fünfzig Männer haben mich am Flughafen empfangen. Als ich in die Stadt kam, habe ich gesehen, wie die Menschen hier leben. Ich bin mit Leib und Seele Afghane, so hat mich Gott geschaffen. Ich bin auf dem Besitz meiner Großeltern aufgewachsen, aber ich konnte reisen und die entsprechenden Schulen besuchen, und irgendwann dachte ich: Ich werde die Welt durch den Sport revolutionieren. Mit Jungen und Mädchen. Ich setze dabei auf Jugendliche unter 17, die einzigen, die noch unverdorben sind. Zuerst mache ich ein Fußballprogramm mit Jungen und Mädchen. Dann einen Boxerinnenverband. Meine Mutter meinte: ,Die bringen dich um. Afghanistan ist noch nicht soweit. Der hiesige Kriegsherr bringt dich um.‘ Aber ich habe meine afghanischen Kleider angezogen und ihm einen Besuch abgestattet, habe mich zu ihm auf den Boden gesetzt und mit ihm gegessen: ,Ist es nicht Zeit, der Welt zu zeigen, wer wir sind? Alle wollen sie das Land wiederaufbauen, aber dazu brauchen wir die Zukunft, und das sind die Kinder und Jugendlichen.‘ Ich hab’ ihn herausgefordert.“
Daran denkt nämlich keiner, wenn versucht wird, dem Opiumanbau einen Riegel vorzuschieben, meint Tarek.
„Den Leuten wird gesagt: ,Hört auf mit dem Opium.‘ Und die Leute fragen: ,Wieso? Was haben wir denn für eine Alternative?‘ Die Welt erwartet, daß diese Menschen, die nichts haben, was sie statt dessen machen könnten, die nicht lesen und nicht schreiben können, sich in sechs Jahren ändern. Wenn man ihnen aber Alternativen bietet, sind sie durchaus dafür offen. Der Typ, der mich angeblich umbringen wollte, bekam feuchte Augen, als ich ihm von meinem Sportprojekt mit den Kindern erzählte, und hat mich einen Engel genannt.“
Inzwischen trainiert Tarek die Boxermädchen bereits. Die jüngste ist zwölf, die älteste 17 Jahre alt.
Ramin führt mich in ein Restaurant, in dem nur Afghanen verkehren, das Bab Amir. Wir setzen uns in den kleinsten Raum, da, wo die Familien sitzen oder, genauer, wo auch Frauen sein dürfen. Ich kann mein Tuch vom Kopf nehmen und auf die Schultern legen. Man bringt bitteren Joghurt, warmes Brot und kabuli, ein Gericht aus gebratenem Reis mit Rosinen, Pistazien, Karottenstreifen und einem Stück Hammelfleisch, alles ausgezeichnet. Und Coca-Cola.
„Unter den Kommunisten haben die Afghanen noch an etwas geglaubt; seit die Amerikaner hier sind, glauben sie an nichts mehr“, sagt Ramin. „Die Amerikaner setzen sich nicht wirklich mit Afghanistan auseinander, und die Leute spüren das. Da liegt der Unterschied zwischen einem Untertan und einem Bürger. Es gibt hier keine bürgerliche Kultur, keine soziale Verantwortung. Nur internationale Verlierer. Hier sind unfähige Ministersöhnchen in der Regierung, und den Amerikanern ist das egal. Accountability lost. Das ganze Geld wird wahllos ausgegeben. Wir haben 400 Schulen gebaut, sagt die USAID. Great. Aber es gibt keine Lehrer und kein Erziehungssystem. Und auch keine Ärzte; sie sind schlimmer als Metzger, niemand bildet sie aus, dafür gibt es kein Programm. Wenn es hoch kommt, sind vielleicht zehn Prozent der finanziellen Hilfe gut angelegt. Sein Ziel erreicht man nur über Bestechung oder indem man über Leichen geht.“
(...)