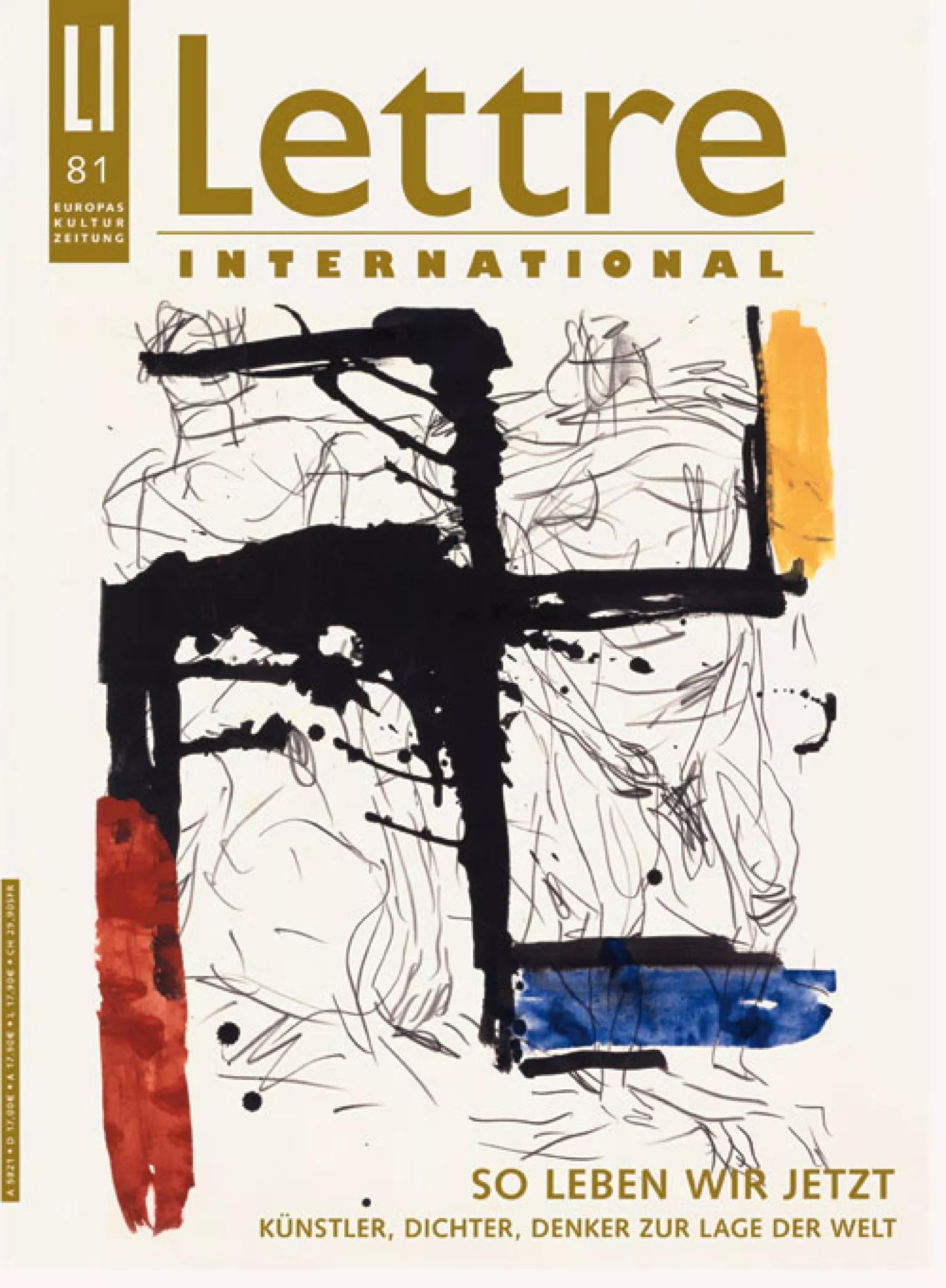LI 81, Sommer 2008
Prothesenkinder
Schutz von dilettantischen Helfern ist ein Menschenrecht der ArmenElementardaten
Genre: Essay, Recherche, Reportage
Übersetzung: Aus dem Nierderländischen von Anne Middelhoek
Textauszug
Angefangen bei lokalen Suppenküchen bis hin zu internationalen Kinderschutzorganisationen: Bildeten alle Hilfsorganisationen zusammen einen Staat, wären sie die fünftgrößte Wirtschaft der Welt. Insgesamt 90 Milliarden Dollar bringen die Geberländer jedes Jahr für Entwicklungshilfe auf. Etwa 9 Milliarden entfallen allein auf die humanitäre Soforthilfe – sozusagen die Erste Hilfe in Kriegs- und Krisenregionen. Eine regelrechte Hilfsindustrie ist entstanden, in der Hunderte internationale Hilfsorganisationen den Geldströmen hinterherreisen und in den Katastrophengebieten miteinander um ein möglichst großes Stück vom Milliardenkuchen konkurrieren. Im Schnitt fließen sechzig Prozent der Gelder in Gehälter, Büros und Tagegelder für eigene Mitarbeiter. Aus diesem Grund und angesichts der mangelnden Erfolge der Entwicklungshilfe entschließen sich immer mehr engagierte Bürger im Westen dazu, eine eigene Hilfsorganisation, eine sogenannte MONGO (My Own NGO), zu gründen. Bill Clinton schreibt in Giving. How Each of Us Can Change the World von einer „explosionsartigen“ Verbreitung solcher privater Initiativen. Er interpretiert diese Tendenz als „beispiellose Demokratisierung der Wohltätigkeit“, als Folge der Tatsache, daß wir dank Internet immer besser wissen, wie es den Menschen ergeht, die unter Kriegen oder Naturkatastrophen leiden. In den Niederlanden sind gut 16.000 Wohltätigkeitsorganisationen registriert. In Großbritannien, den skandinavischen Ländern und Australien sind individuelle karitative Aktionen bereits genauso populär, während die US-amerikanische Bundessteuerbehörde Internal Revenue Service jeden Tag durchschnittlich 83 Freistellungsbescheide für neue Wohltätigkeitsorganisationen ausstellt.
Die Befürworter der mittlerweile riesigen MONGO-Bewegung sind davon überzeugt, daß sie die Krisengebiete besser, schneller und billiger versorgen können als die „richtigen“ Hilfsorganisationen mit ihrer trägen Bürokratie und ihren Unternehmensinteressen. Jeder weiße Land Cruiser der „Richtigen“ kostet in etwa gleich viel wie der Bau eines kleinen Waisenhauses, so rechnen die MONGOs vor, und für den Gegenwert eines vollen Benzintanks ließe sich der Betrieb des Waisenhauses ein Jahr lang finanzieren. Vor den Supermärkten werden Hausfrauen dazu ermuntert, ihre leeren Pfandflaschen zu spenden, Skatclubs und Chorvereine organisieren Wohltätigkeitsveranstaltungen und Basare. In vielen Betrieben spenden die Mitarbeiter einige Prozent ihres Monatsgehaltes für einen guten Zweck, und manche Kommunen „adoptieren“ ein Dorf in einem Katastrophengebiet.
Ein Touristenvisum ist oft das einzige Dokument, das die MONGOs brauchen, um zum Schauplatz der Katastrophe oder zum Krisenherd fliegen zu können. Vor Ort mieten sie ein Auto, bekleben es mit dem Logo ihres Vereins, und schon sind sie „im Geschäft“.
„Ein Menschenrecht, auf das die Armen und Schwachen unbedingt einen Anspruch haben sollten, ist der Schutz vor dilettantischen Helfern“, hat Jan Egeland, bis 2007 UN-Nothilfe-Koordinator, einmal gesagt. Statt dessen wird die MONGO-Bewegung von den Regierungen der Geberländer gefördert. Die „selbstgemachten“ Initiativen kommen der Unterstützung der Entwicklungshilfe durch die Öffentlichkeit zugute, und davon profitiert wiederum die Hilfsindustrie insgesamt. Gescheiterte MONGO-Projekte werden nicht an die große Glocke gehängt, denn Kritik an den selbsternannten Helfern färbt auch auf die Hilfsindustrie als ganze ab, die ohnehin häufig genug unter Beschuß gerät.
(...)