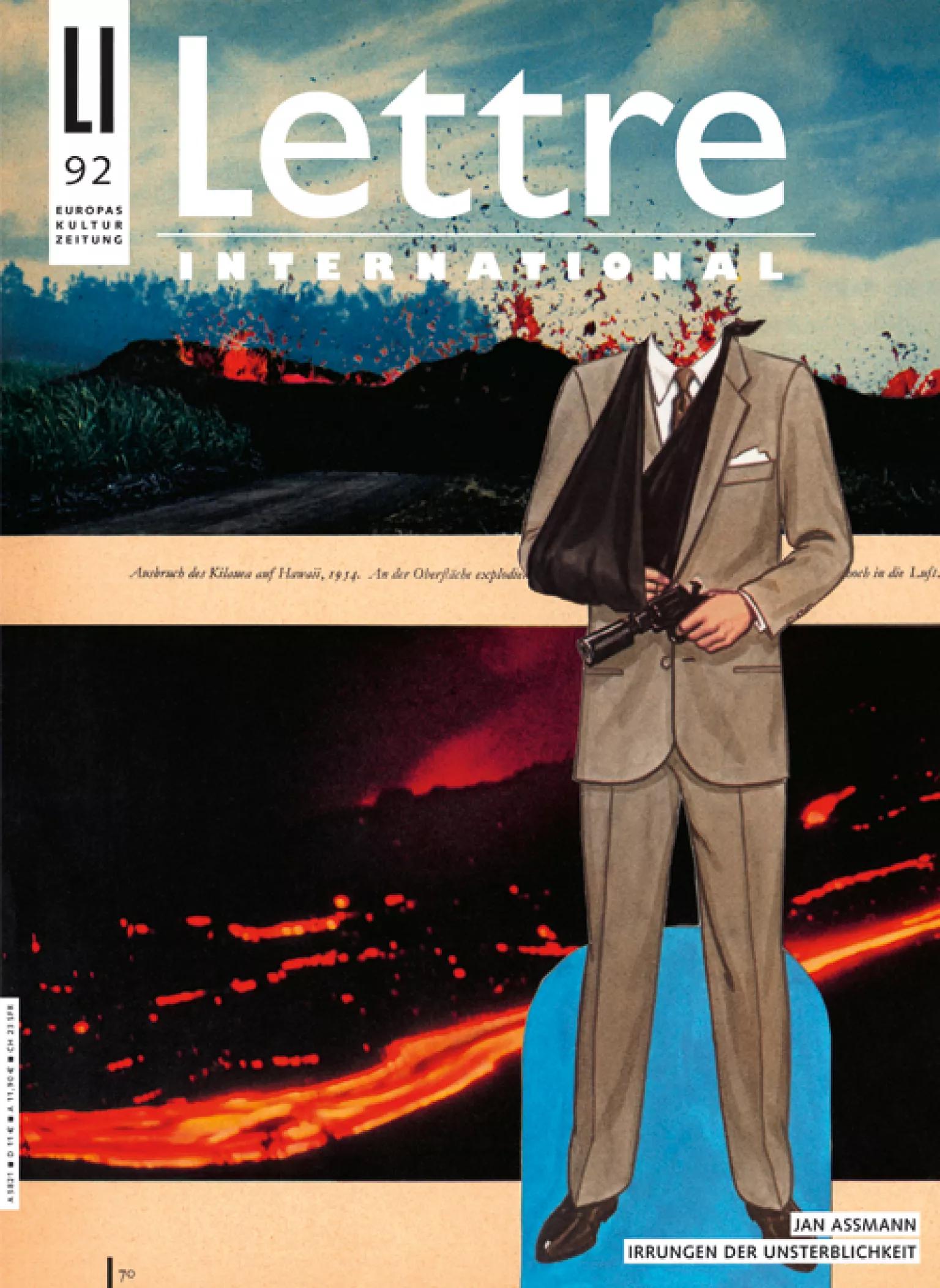LI 92, Frühjahr 2011
Jeder Tag war inszeniert
Krankheit, Einsamkeit, Literatur – Erinnerungen an Thomas BernhardElementardaten
Textauszug
Peter Fabjan: Die Literatur ist nicht meine Stärke. Wenn ich irgendwo hinfahre, um eine Premiere anzuschauen, muß ich den Text vorher nicht zwangsläufig gelesen haben, denn ich habe um mich herum die Forscher des Thomas-Bernhard-Archivs, also Germanisten, Fachleute; als Germanist werden Sie mich nicht beanspruchen dürfen und sollen. (Lacht)
Marek Kedzierski: Ein ungermanistisches Gespräch kann doch viele Anregungen erzeugen, ich möchte das nicht entbehren.
Der Bruder hat gesagt, er habe die autobiographischen Bücher geschrieben, damit nicht wir es sind – meine Schwester und ich –, die nach seinem Tod womöglich Auskunft geben, nicht wir befragt werden über ihn, das wollte er nicht. Wenn es um irgendwas ging, das ist zu seiner Lebzeit vorgekommen, mich ein Journalist etwas gefragt hat und ich dann eine arglose Antwort gegeben habe – da hat er zu mir gesagt: „Um Himmels willen nichts Privates, das ist tabu.“ Ich glaube, es ist nicht falsch, gewisse Dinge zu klären, den Hintergrund aufzuzeigen, warum etwas so und so von ihm gekommen ist.
Was heißt: „privat“? Das ist nur eine hauchdünne Linie zwischen „privat“ und nicht „privat“. Thomas Bernhard hat sehr viel von seinem Privatleben in seine Bücher …
… hineingenommen, aber das waren Erzählungen. Ich sage nicht: „die autobiographischen Bücher“, sondern ich sage mit Vorliebe: „die autobiographischen Erzählungen“. In diesen Büchern hat er die Wirklichkeit, wie wir sie kennen, wie der Vater sie gekannt hat, so hineingenommen, wie er wollte, daß sie aufgenommen werden.
Zum Beispiel?
Wenn er von unserer Wohnung in Salzburg erzählt, die ab 1946 von uns bewohnt wurde, die für acht Personen zu klein war, es waren zwar bald nicht mehr so viele, aber fünf, sechs, sieben waren wir zu Thomas’ Zeiten immer noch, dann war von ihm geschrieben worden, er mußte in dieser Wohnung im Vorhaus schlafen. Tatsächlich mußte er im Vorzimmer schlafen, ein Vorzimmer, wie ein Gang, von dem aus man in die drei übrigen Zimmer gegangen ist, in ein Bad und eine Küche. Acht Personen! Der Großvater hat ein Zimmer für sich beansprucht, ein kleines, der Schriftsteller-Großvater, der Freumbichler, logischerweise, der Vater mußte sogar eine Polstertür machen, damit er nicht unter dem Lärm der Familie leiden mußte. Aber die acht Personen haben nur zwei Zimmer zur Verfügung gehabt. Da waren unsere Eltern, also Mutter, Vater, meine Schwester und ich in einem Zimmer und in einem anderen, da war der Onkel. Die Großmutter mußte in der Küche schlafen und Thomas im Vorzimmer. Es war anders nicht zu machen. Er schreibt nicht: Vorzimmer, sondern: Vorhaus.
Wie erklären Sie diese Änderung?
Im Vorhaus, außerhalb der Wohnungstür, das ist natürlich eine Unmöglichkeit. Ich habe es später verstanden, mein Vater konnte das unmittelbar nicht verstehen, der war wütend. Ich habe das so verstanden, daß Thomas sich als Außenseiter in der Familie, schon wegen des Namens, nicht Fabjan, sondern Bernhard, gefühlt hat.
Der Name Bernhard kam daher, daß Anna Bernhard nicht verheiratet war, als sie Thomas’ Mutter bekommen hat.
Richtig, als unsere Großmutter diese Tochter bekommen hat, hat sie ihr den Namen des ersten Mannes (unserer Großmutter) gegeben, obwohl diese eine Tochter von Freumbichler war. Und sie hat dann, sie war damals nicht verheiratet, wieder ihren Mädchennamen benutzt – sie wollte das offenbar auch nie ändern, oder es war nicht möglich, ihn umschreiben zu lassen, man hätte sie wahrscheinlich adoptieren müssen, dann hätte sie Freumbichler geheißen, dann würde Bernhard Freumbichler heißen. Auch Fabjan, mein Vater, wollte den Thomas Bernhard adoptieren. Er war aber damals, als er in Seekirchen bei Salzburg geheiratet hat, sehr jung, man hat ihm von amtlicher Seite mitgeteilt, er sei zu jung, um diesen Buben zu adoptieren, er solle ein paar Jahre warten, dann könne er das nachholen. Dann kam der Krieg mit ganz anderen Sorgen, existentiellen Sorgen, überhaupt durchs Leben zu kommen, und die Adoption war nicht mehr aktuell. Unser Vater wollte ihn tatsächlich, zunächst mit der Heirat, wollte das ledige Kind, das er ja auch mitbetreut hat, er war sehr lieb zu ihm. Also in Wien waren sie schon zusammen, geheiratet haben sie in Seekirchen bei Salzburg, gegangen sind sie dann, vor dem Krieg, nach Traunstein, und kaum war er in Traunstein, wurde er zum Militär geholt, unser Vater, und man hat ihn nicht mehr gesehen, für ungefähr vier Jahre. Er war hin und wieder auf Fronturlaub, in Soldatenuniform, und hat sich dann gewundert, er hat mich, ich war 1938 geboren, zu Hause mit der Mutter vorgefunden und freudig begrüßt, und die Mutter sagt zu mir – ich konnte gerade stehen –: „Ja wer ist denn da?“ Und ich schaue ihn an und sage: „Ein Soldat.“ Vater habe ich nicht erkannt. Er ist auf einen späteren Urlaub wiedergekommen, und da hat ihn die Mutter kommen sehen, den Vater, in Uniform, er kommt, große Aufregung, ich bin mit dem Thomas hinuntergelaufen. Thomas, sieben Jahre älter, war der schnellere. Er war als erster beim Vater, nicht seinem, sondern unserem, aber der Vater hat, so wurde das später erzählt, wie er mich kommen sah, die Arme nach seinem Sohn ausgestreckt, mir, und den Thomas neben sich stehenlassen. Das waren elementare Erlebnisse, weswegen Thomas sich als Bub zurückgesetzt gefühlt hat, als Außenseiter.
Um auf das Vorzimmer zurückzukommen …
Er hat geschrieben, wie er seine Situation empfunden hat, damals. Auch das Vorzimmer, da waren die Türen in der Nacht zu. Er hat das empfunden, als wäre er außerhalb der Wohnung, und die Empfindung, unter der er als Kind gelitten hat, konnte er weitergeben, indem er nicht gesagt hat: Vorzimmer, wie ein weiteres Zimmer, indem er geschrieben hat: Vorhaus, aus der Wohnung heraus. Seine Darstellung der Realität in der Erzählung verschärft manches, um zu erreichen, daß der Leser spürt, was er damals gespürt hat. Entscheidend ist nicht, daß es sich um das Vorzimmer handelte und er in der Wohnung war; wichtig ist, was er als Kind empfunden hat.
Er benutzt autobiographische Elemente in jedem Werk. Sehen Sie einen Unterschied zwischen den biographischen Texten – die fünf Bände der sogenannten Autobiographie – und den restlichen Texten?
Thomas hat mir gesagt, die autobiographischen Bücher mußte er schreiben, damit man nicht später von uns erfährt, wie es gewesen ist, sondern von ihm. Er hat auch gesagt: „Meine Literatur ist es nicht.“ Er hat es nicht als seine eigentliche Leistung geschätzt; seine Leistung war für ihn seine Prosa. Nicht einmal seine Theaterstücke hat er so geschätzt. Wenn ich seine Prosawerke, Romane, lese, fühle ich mich immer – und dem Vater ging es auch so – angesprochen.
Es scheint, daß es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Thomas-Bernhard-Figuren und Ihnen gibt.
Wenn es in Auslöschung der Johannes ist, hat er zu mir gesagt: „Lies das, der Johannes, das bist du.“ Das meinte er ernst. Wenn ich es lese, denke ich mir: Wie konnte er nur so etwas von mir vermuten, solche Gedanken? Aber ein wesentlicher Teil seines Grunddefizits war fehlendes Grundvertrauen in die Welt, in seine unmittelbare Umwelt, da war immer Mißtrauen, und das ist auch dadurch herauszufühlen, daß er mich sehr analytisch, nüchtern beurteilt hat. Er hat befürchtet, daß manches bei mir so ist, um sich von mir möglichst das Gegenteil vorleben, beweisen zu lassen.
In den Werken, die als „Literatur“ gelten, hat er zwar auch autobiographisches Material verwendet, aber freier. Die Prosa, die manche Kritiker „Autobiographie“ nennen, hat als Ziel, seine wirkliche Person zu schildern, sein Leben „authentisch“ vorzustellen. Als er über sich „autobiographisch“ sprach, fügte er gewisse Dinge hinzu, die gänzlich fiktiv waren, und umgekehrt, wenn er sich über andere geäußert hat, hat er sich selbst in diese anderen Personen hineingeschlichen. Fiktiv oder autobiographisch – er hat manches so dargestellt, wie er gesehen werden wollte.
Er hat sich stilisiert. Er hat einmal zu unserem Vater gesagt: „Ich baue an meinem Denkmal. Das ist jetzt meine Aufgabe.“ In privaten Kreisen hat er solche Sachen ungeniert gesagt. Er hat ein künstlerisches, aber auch ein künstliches Leben geführt. Bei ihm war jeder Tag inszeniert von dem Moment an, wo er sich in die Literatur geflüchtet hat. Oder Zuflucht gesucht hat, weil er gemerkt hat, im normalen Leben geht er unter.
Diese Künstlichkeit, gab es sie auch, bevor er sich für die Literatur entschieden hat?
Naja, er war ein Gefinkel. Eine vipère, wie man auf Französisch sagen würde, ein frühreifer Bursche. Wenn er mit mir gefahren ist, um beim Bauern Milch, Butter oder Eier zu holen, hat er den Tabak mitgenommen, den unser Vater aus Jugoslawien dem Großvater für sein Pfeifenrauchen geschickt hat. Und da man gewußt hat, Tabak ist ein Luxus und das andere Lebensnotwendigkeit, ist er mit mir zu dem Bauern mit dem Tabak. Ich war ein kleiner, sympathischer Blonder. Thomas hat so kalkuliert, daß die Frau des Bauern sich für uns einsetzt, damit er uns mehr dafür geben würde. Daß er mich mitgenommen hat, war nicht reine Liebe zum Konkurrenten.
(…)